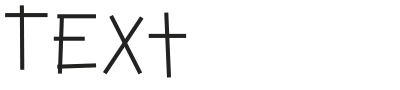Die in Jena lebende Künstlerin Jana Gunstheimer (*1974, Zwickau) arbeitet vorwiegend im Medium der Zeichnung, die installativ oder medial erweitert präsentiert werden. Von 1993 bis 1998 studierte sie Ethnologie und Kunstgeschichte in Leipzig, von 1997 bis 2003 Malerei und Grafik an der Burg Giebichenstein in Halle. Seit 2016 ist sie Professorin für experimentelle Malerei und Zeichnung an der Bauhaus-Universität in Weimar, an der sie soeben IRRE@bauhaus gegründet hat, ein Institut für Regionale Realitätsexperimente. Hier haben wir uns im April 2019 getroffen, um über ihre Ideen zum Institut und ihre aktuelle Arbeit „moelk. Von der guten Absicht“ zu sprechen.
B: Als Du mir davon erzähltest, dass Du IRRE@bauhaus gründen möchtest, fühlte ich mich an NOVA PORTA, die Organisation zur Bewältigung von Risiken erinnert, eine Deiner ersten Arbeiten, in der eine komplexe Welt entworfen wird, in der Protagonisten als POAs, Personen ohne Aufgabe agieren. Wo liegen die Parallelen zwischen diesen beiden Institutionen?
J: Mit NOVA PORTA hatte ich in den Jahren nach der Jahrtausendwende begonnen, es war eine fiktiv angelegte Organisation, die nach und nach immer realer wurde aus dem einfachen Grund, dass die Leute den fiktionalen Charakter nicht erkannt haben und NOVA PORTA beitraten. Die Organisation richtete sich an vorwiegend junge Leute, die nichts mit ihrem Leben anzufangen wussten und die mithilfe von „Maßnahmen“ wieder in die Gesellschaft integriert werden sollten. NOVA PORTA kann man sich als Mischung aus Arbeitsamt und Scientology vorstellen und das schien tatsächlich viele Leute anzusprechen, die sich auf das Spiel einlassen wollten. Ich hatte also wie in einer "normalen" Organisation Mitglieder, die beschäftigt werden wollten, gewisse Erwartungen an die Organisation hatten und mitdiskutieren wollten. Ich bin allerdings eine Verfechterin von diktatorischen Entscheidungen in der Kunst (lacht) und ich war immer bestrebt, eine Form zu erschaffen, die zwischenden Wirklichkeiten liegt.
Was mich an NOVA PORTA gereizt hat, war der Rahmen, in dem ich mich bewegen konnte und der es mir ermöglichte, bestimmte ganz unterschiedliche Rollen im Kosmos von NOVA PORTA einzunehmen. Ich konnte sowohl als Initiatorin von anthropologischen Untersuchungen wie auch als deren Teilnehmerin auftreten, als Beobachtende oder Beobachtete, und in der Zusammensetzung dieser verschiedenen Wahrnehmungs- und Erzählmuster ergab sich für mich die Möglichkeit, multiperspektivische Welten zu erschaffen.
B: Wie würdest Du die Arbeitsweise von IRRE@bauhaus umreißen? Ist der Name hier Programm?
J: Bei der Gründung des Instituts an der Bauhaus-Uni geht es um ähnliches: wie kann ich als KünstlerIn so arbeiten, dass ich mir einen eigenen Kosmos schaffe: meine eigenen Arbeitsmethoden, Kommunikationsformen, Ästhetiken etc. Ich verstehe das Institut als ein Gefäß, dessen Form und Funktion von den Beteiligten erst definiert wird. Und dieses Gefäß sieht immer anders aus, je nachdem, aus welcher Position und mit welcher Konditionierung man darauf schaut. Über das Institut und darüber, was wir dort tun, werden Dinge behauptet, die für sich genommen schlüssig sind, die aber kein geschlossenes Bild ergeben. Für jeden der am Institut arbeitenden scheint es etwas anderes zu sein, eine eigene Realität, die zur Realität der anderen nicht zu passen scheint. Wir haben hier also keine starren hierarchischen Strukturen, wie das bei NOVA PORTA der Fall war, sondern ein amorphes fluides Gebilde, das von allen Beteiligten definiert wird.
Bei der Namensfindung ging es uns einerseits darum, einen Kontrapunkt zum Bauhaus zu setzen, unter dessen Dach wir uns befinden. Ich finde sehr interessant, dass in der aktuellen Diskussion des Bauhauses immer wieder schon fast verzweifelt nach Visionen für unsere Zeit gerufen wird. Diese Sehnsucht nach einem radikalen Bruch, den man in die Gründungszeit hineininterpretiert, und die Suche nach Parallelen im heute ist ein spannendes Arbeitsfeld für uns.
Das IRRE im Namen ist die Abkürzung für Institut für Regionale Realitätsexperimente, eine Bezeichnung, die sich niemand wird merken können (lacht). IRRE allerdings schon…
B: Im Namen steckt zum einen das Regionale, die Beschäftigung mit der unmittelbaren Umgebung, zum anderen Realitätsexperimente. Was ist damit gemeint?
J: Wir beschäftigen uns mit allem, was schiefgeht und was besser laufen könnte. Oder was zu gut läuft, aber in die falsche Richtung. Ganz konkret kann man sich das so vorstellen: wir inszenieren im ländlichen Raum mögliche Zukunftsszenarien und erproben in ihnen u.a. verändertes Sozialverhalten.
Ich hatte, nachdem ich mich in den letzten Jahren eher der selbstreflexiven künstlerischen Arbeit gewidmet habe, das Gefühl, dass es jetzt an der Zeit ist, mich wieder mehr mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Und zwar mit einer Gesellschaft, die nicht nur aus einer Kunst sammelnden Elite besteht, sondern auch aus kunstfernen Teilen der Bevölkerung. Ich halte nichts von sozialpädagogischen Ansätzen in der Kunst, ich möchte auch nichts verbessern. Aber ich glaube, dass es eine Form künstlerischer Arbeit gibt, die eine ähnliche Suggestionskraft entwickeln kann wie die Literatur. Dabei ist es mir auch wichtig, eine Arbeitsform zu entwickeln, an der andere teilhaben können. Und das nicht nur als Protagonisten meiner Erzählungen, sondern indem sie mit ihrem Verhalten und ihren Reaktionen den Verlauf der Erzählung beeinflussen können.
Dabei arbeiten wir am Institut mit künstlerischen Methoden, die man unter natur- oder geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten als unorthodox bezeichnen könnte. Uns interessieren Themen der Sozialanthropologie: neue Arbeitsformen, politische Umgruppierungen, überhaupt: das Zusammenleben von Individuen in der Gesellschaft, ihre Organisation, ihre Werte, Normen, Bräuche, die ständigen Veränderungen unterworfen sind. Vielleicht kann man es so zusammenfassen: wir betreiben Symptomforschung an der Gesellschaft. Das machen wir aber nicht als Soziologen, sondern als KünstlerInnen mit unseren ganz eigenen Methoden.
B: Wie würdest Du künstlerische Methoden von denen der Wissenschaft unterscheiden?
J: Übertreibung, Verkehrung ins Gegenteil, Kombination von gegensätzlichen Arbeitsweisen sind Mittel der Kunst. Ebenso wie Inszenierung, absurde Wendungen, gefühltes Wissen oder die Vermischung von Realität und Fiktion. Durch den Einsatz all dieser Mittel kannich Atmosphären erzeugen, die der Realität oft näherkommen als blanker Realismus. Ich nehme leider wahr, dass sich die Kunst immer mehr der Wissenschaft annähert und deren Arbeitsmethoden übernimmt. Ich bezweifle aber, dass Wissensproduktion und Erkenntnisgewinn nur ein Privileg der Wissenschaft sein kann.
B: In Deiner neuen künstlerischen Werkgruppe „moelk“ konstruierst und zugleich dokumentierst Du die Idee einer Bewegung, fast möchte man sagen einer Glaubensgemeinschaft, die sich für das besagte neue Milchprodukt "moelk" einsetzt. Kannst Du das etwas näher erläutern?
J: Zu moelkgibt es folgendes zu sagen:
Ich wollte etwas über einen Stoff oder eine Substanz machen, zu dem alle eine Meinung oder eine Haltung haben und Milch fand ich in diesem Zusammenhang extrem interessant. Milch ist scheinbar in der Lage, die Gesellschaft zu spalten in Milchtrinker und Milchverweigerer, sie kann sowohl Begeisterung als auch Aversionen hervorzurufen. Es gibt ethische Gründe für den Milchverzicht, Laktoseintoleranz, es gibt eine ganze Industrie, die Ersatzprodukte herstellt. Und es gibt Bewegungen, die das Trinken von Milch als der „arischen Rasse“ vorbehaltene Handlung deklarieren und solche, die dagegen demonstrieren. Und nicht zu vergessen: Milch fördert das Wachstum.
B: Ist Moelk nur eine andere Bezeichnung für Milch oder hat es noch andere Qualitäten?
J: Moelk ist ein Produkt, das entwickelt wurde, um zwei Probleme gleichzeitig anzugehen: den einbrechenden Umsätzen der Milchindustrie entgegenzuwirken sowie ein Mittel gegen die gesellschaftliche Spaltung, die überall thematisiert wird zu entwickeln. Das eine hat mit dem anderen nicht das Geringste zu tun und genau das ist es, was es interessant für mich macht.
Es gibt hier also einen Stoff, den man als den Stoff der Zukunft bezeichnen könnte, der laut Aussage der Entwickler wahre Wunderwerke zu verrichten in der Lage ist. Mit diesem Stoff bin ich in den letzten Monaten in Südthüringen unterwegs gewesen, um ihn und seine Wirksamkeit zu testen.
B: Du erzählst, dass Du übers Land gefahren bist, um moelk bekannt zu machen bzw. zu testen. Welche Erfahrungen hast Du dabei gemacht? Und wie sind diese in Deine Arbeit eingeflossen?
J: Ich kam mir dabei manchmal vor wie „Herr Wichmann von der CDU“ (lacht). Ich hatte im Vorfeld Treffen vereinbart, bei denen möglichst viele Teilnehmer anwesend sein sollten, die nicht unbedingt einer Meinung sind. Es gab Treffen mit Gegnern und Befürwortern einer Stromtrasse, Gemeinderatsversammlungen, Geflügelzüchtervereinen etc. Ich kam also dorthin, meist hatte ich einen oder zwei Mitstreiter dabei und stellte moelk vor. Nun kam der schwierige Teil: ich musste die Leute davon überzeugen, dass sie das Produkt testen und zwar sofort und gemeinsam mit allen Anwesenden. Moelk zu testen bedeutet folgendes: Aus einem zähflüssigen Ausgangsmaterial, dessen Hauptbestandteil Milch ist, entsteht durch gemeinsames Kneten, Ziehen, Bearbeiten eine Form, die man vielleicht als „erstarrtes Gruppenprofil“ lesen kann, als eine Art sozialer Plastik. Die gemeinsame Arbeit soll verbindend wirken und eine neue Basis für Kommunikation eröffnen. Soviel zur Theorie. In der Praxis mussten wir uns mit einer Flut an hämischen Kommentaren, Beschimpfungen, Verweigerungen usw. auseinandersetzen, die wiederum zum Ausgangspunkt meiner Arbeit wurden. Und ich ernährte mich in dieser Zeit quasi ausschließlich von Rostbrätl mit Bratkartoffeln.
B: Du bewegst Dich in den verschiedenen Terrains von Romanerzählung, Journalismus, Ethnologie, Marketing… Worin siehst Du Dein besonderes Potential als Künstlerin heute?
J: Ich möchte etwas betreiben, das zwischen diesen Kategorien liegt, beziehe mich aber auf eine ethnologische Arbeitsweise, konkret die der Interpretativen Anthropologie, die in den 70iger Jahren von Clifford Geertz entwickelt wurde. Er setzt die Feldforschungssituation mit einem literarischen Text gleich, dem man sich interpretativ nähern sollte und dessen vielfältige Bezüge und Verweise vom Beobachter in einer thick description (dichte Beschreibung) erfolgen sollte. Das schnelle interpretative Erfassen der Gesamtsituation, so Geertz, lässt Relevantes von Irrelevantem unterscheiden.
Was mich an dieser Arbeitsweise interessiert, ist erstens das quasi literarische Arbeiten. D.h., dreht man die Arbeitsweise der Interpretation von Gesehenem um (ich arbeite ja nicht nur an der Beobachtung von Ethnien oder Gruppen von Aussteigern etc., sondern auch an der fiktionalen Erschaffung derselben), so kann ich mit einer dichten Beschreibungsowohl in literarischen Texten, sachlichen Beschreibungen und Analysen von Situationen, in dokumentarischem „Fotomaterial“, sehr persönlichen Skizzen, Diagrammen, O-Tönen, Interviews mit Experten, dem Sammeln von Artefakten u.v.m. eine nicht generalisierende, sondern interpretierende „Erzählung“ ermöglichen.
B: Was reizt Dich, Dein künstlerisches Konzept vermittels immersiver Strategien der Werbung und Propaganda jenseits des gewohnten Kunstkontexts des White Cube von Museum, Kunstverein oder Galerie in die breitere Öffentlichkeit zu verbreiten?
J: Mich interessieren einfach Standards, die wir als gesetzt ansehen und an denen man nur scheitern kann. „Erst wenn’s peinlich wird, wird’s interessant“ sagte Thomas Rug einmal, bei dem ich studiert habe. Ich möchte in meiner Arbeit nicht den Anschein erwecken, dass ich alle Vorgänge der Welt, die mir begegnen, verstehen könnte. Kunst resultiert oft gerade aus dem Nicht-Verstehen von Dingen, zu denen man auf einer anderen Ebene Zugänge finden kann, die sich nicht in Sprache fassen lassen.
Ich arbeite auch so. Auf der einen Seite gibt es das Versenken in den Arbeitsprozess. Da bin ich in einer Welt, in der es kein außen gibt und in der ich nichts abgleichen muss mit Dingen, die ich mir vorgestellt habe. Ich lasse dem Prozess also seinen Lauf. Irgendwann sitze ich dann da mit einem Haufen fast vollendeter Zeichnungen, die überhaupt keinen Sinn zusammen ergeben und zu denen ich das Verbindende erst herstellen muss.
B: Wenn Du hier die Zeichnung ansprichst, so ist sie in ihrer beeindruckenden Qualität das, was einen zuerst anspricht. Würdest Du Dich in erster Linie als Zeichnerin sehen? Und welche Rolle spielt dabei der blaue Zeichenstift?
J: Ich konnte eine ganze Weile lang keinen Zeichenstift mehr sehen und war begeistert von allem Möglichen: Farbe auf Leinwände zu schmieren, Dinge ohne erkennbaren Verwendungszweck daraus zu nähen, meine Bilder auszupeitschen etc. Diese Abstinenzzeit vom Zeichnen brauchte es, um mich jetzt wieder voll und ganz davon einzunehmen. Was man mit dem Zeichenstift alles machen kann: Realitäten erschaffen wie auch einfach nur Gekritzel aufs Papier zu bringen. Ich habe in meinem Leben so viel gezeichnet, dass es mir nicht schwerfällt, neben erkennbar dokumentarischen Aufzeichnungen auch absoluten Unsinn zu zeichnen, der eine ähnliche Präsenz hat.
Der blaue Zeichenstift, der Assoziationen zur Blaupause weckt, spielt in dieser Arbeit eine wichtige Rolle. Er wird anders gelesen als ein Bleistift, der viel mehr der künstlerischen Sphäre zugeordnet wird. Der Kopierstift wiederum kommt aus der Büroarbeit, es steckt auch etwas Gequältes in ihm und das Arbeiten geht nicht so flüssig von der Hand. Aber ich nehme gern Bewerbungen von Leuten entgegen, die sich als Buntstiftspitzer betätigen wollen.
Das Interview führte Bronislaw Malinowski
……………………………………………………………………………………………………………………………….
„MOELK. Von der guten Absicht“ ist vom 26. April bis 4. Juni 2019 in der Galerie Feldbusch Wiesner Rudolph, Berlin zu sehen sowie in der Ausstellung „Bauhausfrauen“ in der Kunsthalle Erfurt vom 19. April bis 14. Juli 2019
http://feldbuschwiesnerrudolph.com
http://www.janagunstheimer.de/nova-porta/
So richtig hell wird es in Jana Gunstheimers Welt nie. Ihr Werk bewegt sich metaphorisch gesprochen in einer twilight zone, einer raumzeitlichen Passage des Übergangs zwischen Licht, Dämmerung und Dunkelheit, in der nie ganz klar ist, ob die Dinge, die man sieht, oder die Schatten, die sie werfen, mehr Realität für sich beanspruchen können. Das gilt bereits für ihr erstes großes Projekt NOVA PORTA (2005–2010), in dem die Künstlerin eine „Organisation zur Bewältigung von Risiken“ erfand, die – in einem vage postapokalyptischen Setting – für all diejenigen, die als „Personen ohne Aufgabe“ unter Perspektivlosigkeit leiden, streng formalisierte und zugleich merkwürdig sinnentleerte Strukturen und Rituale anbot. Seitdem geht es in ihrem Werk-Kosmos darum, Bilder als Möglichkeitsräume zu entwerfen, die nicht nur alles Erdenkliche in sich aufnehmen können, sondern auch eine strukturelle Unentscheidbarkeit darüber enthalten, welchen Status sie eigentlich selbst beanspruchen. Das liegt vor allem daran, dass diese konsequent in Schwarz-Weiß entworfene Bild- und Objektwelt so präzise und realistisch erscheint, dass man auf den ersten Blick kaum umhin kommt, sie für glaubhaft zu halten.
Insbesondere trifft das auf Methods of Destruction (2011/12) zu. In dieser Werkgruppe beschäftigt sich Jana Gunstheimer mit verschiedenen berühmten Gemälden der Kunstgeschichte, von Caravaggios Abendmahl in Emmaus (1601) über Goyas Erschießung der Aufständischen (1814) bis hin zu Spitzwegs Schmetterlingsjäger (1840) und Klees Scheidung Abends (1922), die uns in diesem Kontext allesamt als zerstörte Werke wiederbegegnen. Auch wenn die Attacken auf diese Bilder selbstverständlich erfunden sind, lässt der Gestus, in dem die Künstlerin diese ikonoklastischen Akte inszeniert, doch auch den informierten Betrachter zweifeln, ob er hier nicht vielleicht etwas übersehen hat: Sorgsam in Archivkladden abgelegt, mit wissenschaftlichem Glossar versehen und präzise bis ins letzte Detail in Schwarz-Weiß-Zeichnungen übertragen, atmet das Konvolut genau die Aura objektiver, taxonomischer Wissenschaftlichkeit, die wir gemeinhin als Grundlage für die Trennung des Faktischen vom Fiktiven betrachten. Und es ist genau diese Trennung, die Jana Gunstheimer nicht interessiert, ja, die für sie letztlich unproduktiv ist. Diese Künstlerin arbeitet vielmehr mit den Mitteln realistischer Präzision daran, den Realismus und die Vorstellung einer objektiv gegebenen Wirklichkeit zu widerlegen. Insofern ist jedes ihrer Bilder in erster Linie eine sinnliche Halluzinationsleistung, die der Erfindung sich selbst widerlegender Bilder dient.
Damit folgt sie kunsthistorisch gesehen einer Art Schattenlinie der Moderne, die, von der Pittura Metafisica und dem Surrealismus ausgehend, sich radikal gegen das Selbstermächtigungsversprechen richtet, mit dem – vom Kubismus über den Suprematismus, bis hin zu Minimal Art und Konzeptkunst – die Avantgarde versucht hatte, der Kunst einen reinen, objektivierbaren Autonomiestatus zu verschaffen. Bei Jana Gunstheimer führen die Bilder dagegen in die Darkrooms tief ineinander verschlungener Labyrinthe, in denen das surrealistisch gefärbte Mysteriöse, Düstere und Dystopische deutlich mehr Gewicht hat als das helle, harte Licht aufklärerischer Klarheit und rationaler Logik. Mit großer Lust folgt die Künstlerin beispielsweise der Idee des latenten, abwesenden, ausradierten Bildes, für das sie in dem Projekt Image in Meditation (2015) sogar einen fiktiven Bau entworfen hat, in dem Pale Objects (2014) und Images of a Non-Permanent Image (2014) ein geheimnisvolles Schattenleben führen. Nichts ist hier verlässlich, nichts stabil. Für alles, was erscheint, gibt es auch etwas, das verschwindet, und jedes Bild träumt von einer dreidimensionalen Existenz, die doch ihrerseits wieder nur ein Schatten einer nicht greifbaren Wirklichkeit wäre.
Es ist insofern nur folgerichtig, dass Irrige Vorstellungen kausaler Zusammenhänge (2014), eine der neueren Werkgruppen Jana Gunstheimers, die konventionellen Vorstellungen von Ursache und Wirkung gleich ganz auf den Kopf stellt und uns mit einer vom Schöpfer selbst kommentierten Schöpfung konfrontiert, in der nicht nur einiges schiefgelaufen zu sein scheint, sondern selbst die Ausgangspunkte für die Schöpfung nur mehr in Form leerer schwarzer, auf die Wand gemalter Bildrechtecke existieren, welche die fehlenden Exponate symbolisieren. Die Abwesenheit der Ursache führt dann auf der gegenüberliegenden Wand zu Ergebnissen, die nicht anders als merkwürdig, also als bemerkenswert bezeichnet werden können: Seltsame Homunculi-Wesen, von der Künstlerin zunächst aus Knetmasse geformt und dann in die Schwarz-Weiß-Zeichnung übertragen, markieren den Punkt, an dem die studierte Ethnologin Jana Gunstheimer dem Versprechen ihres Faches auf saubere Herkunftsableitungen und Kausalketten ebenso eine spöttisch-ironische Absage erteilt, wie sie zugleich den christlichen Schöpfungsmythos kritisch hinterfragt. Was wir zu sehen bekommen, sind die Konstruktionen von Bildern, zu denen es keine logischen, konsistenten Realvorbilder gibt, die Evokation einer Bildwirklichkeit, die sich aus sich selbst heraus zeugt, obwohl sie verschiedenste Verbindungen in unsere gewohnte Realität aufzuweisen scheint.
Im Zentrum dieser hochkomplexen Auseinandersetzung mit den Fragen der Bildwirklichkeit und Bildkonstruktion steht der Begriff des Abwesenden, das in diesem Werk immer wieder in unterschiedlicher Form auftaucht. Als Latenzphänomen spielt es auf das Versprechen einer zukünftigen Bildevidenz an, die sich freilich nie zeigt. Als übersinnliche Erscheinung (Eiskaltes Licht, 2010) verweist es auf einen Bereich, der sich dem menschlichen Zugriff entzieht. In seiner Gestalt als Destruktion (Methods of Destruction) verknüpft es die Zerstörung mit einer Neukonstituierung des Bildes als nicht mehr verfügbares und deshalb umso begehrenswerteres Erinnertes. In jedem dieser Fälle ist das Abwesende, das Fehlende nicht einfach Leerstelle, fundamentaler Verlust, sondern zugleich Ziel des Bildbegehrens. Oder anders gesagt: ein Abwesendes, aus dem sich zugleich das Anwesende generiert.
Im hier vorliegenden Katalog Luft nach oben zeigt sich diese Dialektik ganz besonders deutlich. Jana Gunstheimer hat hier ältere und neue Arbeiten versammelt, die zum einen die Verbindung zwischen Bild und Körper betonen und damit auch – in einem beinahe animistischen Sinne – das Bild und die ihm oft beigefügten Objektkörper als menschliche Wesen behandeln. Zum anderen kämpfen viele dieser Arbeiten mit einer grundsätzlichen Ermüdung, die mitunter auch einem Erlöschen, einer Auslöschung gleicht. Das betrifft ganz sicher das erased drawing, das zugleich natürlich auf einen der berühmtesten und paradoxesten ikonoklastischen Akte der Kunstgeschichte anspielt: Robert Rauschenbergs Erased de Kooning Drawing aus dem Jahre 1953. Rauschenberg hatte damals an der Frage gearbeitet, inwieweit es möglich wäre, ein Kunstwerk zu schaffen, das allein aus seiner Tilgung besteht. Nachdem er innerhalb seiner eigenen Arbeit dabei zu keiner Lösung gekommen war, konnte der Künstler den von ihm bewunderten Willem de Kooning dazu überreden, ihm eine Zeichnung zu überlassen, die er dann in einem annähernd zweimonatigen Prozess ausradierte. Damit vollzog Rauschenberg nicht nur einen imaginären Vatermord, sondern mindestens ebenso sehr eine ehrende Verneigung vor de Kooning, dessen Zeichnung nun, in ihrer fast gänzlich gelöschten Palimpsestgestalt, in gewissem Sinne wirklicher, begehrenswerter und wichtiger wurde, als sie es in ihrem Originalzustand je hätte sein können.
Jana Gunstheimers Dialektik des Abwesend-Anwesenden begreift – wie oben skizziert – das Bild dabei immer als einen mit menschlichen Attributen (und Empfindungen) ausgestatteten Körper. Drawing Done with Sinking Motivation (2017), eine Folge von vier Schwarz-Weiß-Zeichnungen, zeigt von links nach rechts ein Hemd, das sich auf dem ersten Blatt noch so selbstbewusst vor uns aufbaut, als stecke ein Oberkörper in ihm, der aber tatsächlich gar nicht vorhanden ist, um dann in den folgenden Blättern immer mehr in sich zusammenzufallen, bis es auf dem letzten nur mehr eine schlaffe Hülle, eine Art seine eigene Leere bedeckendes Leichentuch geworden ist. Arm dran sind auch Bilder, bei denen die Leinwand offensichtlich nicht mehr ausreichte, um den Keilrahmen ganz zu bespannen (Armes Bild, 2017). Überall an den Seiten klaffen Lücken und es braucht schon zwei straffe Gurte, um dieses ganze Elend einigermaßen in Form zu halten. Oder es gibt – innerhalb der Werkgruppe der Nomaden-Bilder (2016/17) – eine in mehreren Schichten komplett schwarz bemalte Leinwand, die ihrerseits durch ganz unterschiedliche Kantenverläufe, Löcher und Beschädigungen vom Prozess eines dauernden Abspannens und Aufspannens der Leinwand auf verschieden große Keilrahmen kündet. Immer wieder wurde hier – offensichtlich zunehmend verzweifelt – versucht, die richtige Größe, die richtige Proportion für das Bild zu finden. Aber was wir sehen, ist eben nicht nur Dokument eines Scheiterns, sondern ebenso gut auch das auf einer Leinwand ausgebreitete Modell einer Schichtung, in der sozusagen alle Bilder in einem einzigen Bild enthalten sind, das sich seinerseits schwarz verschließt.
Ein klein wenig erinnert das an Robert Gobers frühe, radikale Auseinandersetzung mit dem Medium der Malerei. Ein Jahr lang hatte Gober eine nur rund 28 x 35 Zentimeter große Leinwand mit immer neuen Bildern aus seinem psychoanalytisch aufgeladenen Motivrepertoire (Landschaften, Abflüsse, Rohre, menschliche Oberkörper) übermalt, und dabei jeden Zustand des Bildes mittels Kamera festgehalten. Aus den Tausenden von Dias entstand Slides of a Changing Painting (1982/83), eine knapp neunzig Bilder umfassende Diaprojektion, die von der steten Metamorphose des Bildes kündet, das in sich alle Bilder enthält und als Projektion zugleich deren reales Verschwinden noch betont. Die Idee eines Bildes, das sich quasi nur zeigt, indem es sich zugleich überdeckt, verschwindet, auslöscht, steckt auch in den zwei kleinen Arbeiten Jana Gunstheimers, die nicht nur Skin (2017) als Titel, sondern buchstäblich, mit ihren abgerollten, von Gurten getragenen Leinwänden, ihre Haut zu Markte tragen.
Das Moment der Schichtung, das Palimpsest, das Verschwinden und die Zerstörung, also wesentliche Parameter des Gunstheimerschen Bilddenkens bündeln sich in Scratches (2017). Die meist großformatigen Arbeiten dieser Serie entstehen in zwei miteinander verknüpften Schritten. Eine spontane, fast automatische Zeichnung, ausgeführt mit einem Aquarellstift in Delfter Blau, wird am Computer mit der Maus bearbeitet und wiederum auf die Leinwand übertragen. Gewissermaßen reagieren hier zwei kompositorische Strategien aufeinander. Der nahezu unbewusste Gestus der Ursprungszeichnung, bei der sich die Künstlerin mehr Freiheit gestattet als je zuvor in ihrem Œuvre, wird gekontert durch die bewusste und überlegte zeichnerische Reaktion am Computer. Andererseits verstärkt sich durch diese Konfrontation der gewissermaßen unfassbare Eindruck der Zeichnungen. Als wollte die digitale Computerzeichnung mit ihren dicken, rahmenden Linien dem analogen Automatismus des Aquarellstiftes unbedingt etwas Lesbares abtrotzen und würde gerade dadurch die strukturelle Unzugänglichkeit des Bildes noch hervorheben.
So irrt das Auge auf diesen Oberflächen umher, meint mitunter, verführt durch das Delfter Blau, in Umrissen und mäandernden Linien flämische Landschaftselemente oder barocke Wolkenformationen zu entdecken, und muss sich letztendlich doch eingestehen, dass da nie mehr war als Linien, die nichts von sich wissen, und solche, die auf deren Unwissenheit reagieren. Und das Ganze dargeboten in diesem Blau, das nicht nur Delft in sich trägt, sondern ganz profan auch die Erinnerung an die gute alte Blaupause, dieses blaue Durchschreibepapier zur analogen Kopie von Dokumenten. Diese Bilder sind als Originale immer schon ihr eigener Abzug, ihre eigene Kopie, eine Pause im doppelten Sinn und verweisen so auf all das Abwesende, das in ihnen steckt. Jeder Strich, jede Linie ist einerseits eine Einschreibung, die das Bild konstituiert, und zugleich ein Kratzer (scratch) auf der Haut der Bildoberfläche, eine Verletzung, die das Bild angreift und (partiell) zerstört. Weil es nur so, in diesem eigentümlichen Gleichgewicht zwischen Selbsterfindung und Selbstdestabilisierung überleben kann.
1 Vgl. Stephan Berg, In der Zwischenwelt, in: Jana Gunstheimer, Ausst.-Katalog Galerie Römerapotheke, Zürich 2005, S. 1.
2 Ausstellung Museum Morsbroich, Leverkusen, 8.11.2015 – 28.2.2016.
3 Vgl. dazu: Jana Gunstheimer. Image in Meditation. Imaginäre Passagen durch ein Bauwerk / Imaginary Passages through a Building, hrsg. von Fritz Emslander, Ausst.-Katalog Museum Morsbroich, Leverkusen, Verlag für moderne Kunst, Wien 2015.
„Der Künstler ist keiner Realität verpflichtet. […] Aber er muss einen Raum schaffen, in dem die Dinge miteinander klingen können, sich begegnen, sich widersprechen, sich bekämpfen und aussöhnen. Unvereinbares steht beieinander, im Zwischenraum blüht die Fantasie.“ (Jana Gunstheimer)
Raum schaffen
Der Bildraum ist für Jana Gunstheimer ein Möglichkeitsraum, der alles Erdenkliche in sich aufnehmen kann. Im Bildraum einzelner Werke bringt die Künstlerin Fragmente möglicher Realitäten zusammen, mit dem nun erstellten „Bau“ hat sie einen komplexen Raum geschaffen, in dem mehrere ihrer Werke und Werkgruppen sich begegnen und zueinander verhalten können – eine Art Meta-Raum. In diesen Bau lagert Jana Gunstheimer ihre Arbeiten aus, zieht mit einem Teil ihres Œuvres in ihn ein. Über die Seiten dieses Buches verteilt, legt sie nach und nach dessen Grundrisse aus. Dabei erfahren wir nicht, ob sie die Architektur unverändert genutzt und ihre Werke in die vorhandene Architektur eingeräumt hat oder ob sie erst einzelne Räume für bestimmte Werkgruppen hergerichtet oder eigens errichtet hat. Dann könnte man in dem Gebäude eine Ordnungsstruktur vermuten, es als eine Art mentale Karte der Gedanken- und Werkprozesse seiner Erbauerin lesen. Ähnlich wie Der Bau von Franz Kafka (Abb. 1) würde Gunstheimers Gebäude tiefe Einblicke in das Innenleben seiner Erbauerin gewähren. In einem fortwährenden Prozess scheint der Bau hier wie dort Stimulus für weitere Gedanken und Werkstrategien gewesen zu sein, die wiederum im Bau ihren Niederschlag gefunden haben.
In seiner unvollendeten Erzählung Der Bau lässt Kafka ein Tier (wohl einen Dachs) auf seinen vermeintlich sicheren Bau blicken. Er ist ihm Trutzburg und Rückzugsort gegen eine feindliche Außenwelt. Eine reich gefüllte Beutekammer dient nicht nur der Absicherung im Sinne der Vorratshaltung, sondern mit ihren Trophäen auch der Selbstversicherung. Nur kurz dauern die Ausflüge in die Oberwelt an, bis der monologisierende Baumeister wieder lauernd und zunehmend an der Perfektion seines Werks (ver-)zweifelnd vor dem moosbedeckten Eingang verharrt: „Mir ist dann, als stehe ich nicht vor meinem Haus, sondern vor mir selbst, während ich schlafe.“ Der Bau wird zum Alter Ego. Bei jedem Wiedersehen tritt das in seiner Selbstreflexivität unheimlich menschliche Tier in Zwiesprache mit dem Bau, mit den von ihm erschaffenen Gängen und Plätzen – als würde es mit alten Freunden plaudern.[1]
Auch Jana Gunstheimer unterzieht ihr Gebäude einer wiederholten Befragung und Revision. Sie distanziert sich, um sich schreibend anzunähern, was es ihr ermöglicht, neue Perspektiven sowohl auf den Bau selbst als auch auf die dort platzierten oder noch unterzubringenden Bildwerke zu gewinnen. Zunächst mehr tastend und ahnend als klarsehend, umkreist sie das Gebäude mit Worten. Sie delegiert die Außenansicht an einen Erzähler, der erste mögliche Reaktionen skizziert: unvermittelte Überwältigung und Staunen ob der schieren Größe und Unübersichtlichkeit des Baus, Unverständnis angesichts der scheinbaren Planlosigkeit, Irritation und Beunruhigung ob seiner Rätselhaftigkeit. In einer Art Endzeitszenario nimmt der nach außen komplett isolierte Bau fast mythologische Züge an, sphingenhaft in seiner Verweigerung, das Innere preiszugeben und – nach einem vermeintlichen Schwelbrand – bedrohlich wie der Orkus, der jeden verschlingt, der es wagt, das Tor zu öffnen und seine Schwelle zu überschreiten.
Texte dienen Jana Gunstheimer zurFindung einer Erzählhaltung und sukzessiven Ausformulierung von Ideen für eine neu zu entwickelnde Werkgruppe: „Ich komme durch das Schreiben zu Formeln, die ich darstellen kann, durch eine Art Selbstgespräch in Textform.“ Mit Worten lassen sich die anfängliche „Ratlosigkeit, mein Gefühl einer Arbeit gegenüber, die im Entstehen ist, in allen Facetten“ durchleuchten.[2]Im Arbeitsprozess geht die Künstlerin ein intensives, fast symbiotisches Verhältnis mit dem Text ein, wie dies die von Gunstheimer geschätzte Hélène Cixous beschrieb: „Zwischen ihm [dem Text] und mir gibt es Tag und Nacht einen Austausch. […] In gewisser Weise lebe ich fortwährend mit ihm. Alles mögliche, das ständig in mir kocht, Wünsche, Emotionen und Unruhe, greife ich unaufhörlich auf, um es an diesen anderen Körper, der gerade neben mir entsteht, weiterzugeben.“[3]
Textkörper und Baukörper wachsen in Jana Gunstheimers Projekt in einem engen Verhältnis wechselseitiger Impulse und Abhängigkeiten, wobei der Bau auch in Plänen und Modellen Gestalt annimmt. Mit Kafkas Baugemeinsam hat Gunstheimers Gebäude seine Verschlossenheit, eine enorme, nicht einsehbare Tiefenerstreckung und das Labyrinthische der Anlage, deren Finessen und innere Logik sich dem Außenstehenden niemals bis ins Letzte erschließen werden. Was das Innere anbelangt, kann auch der Erzähler nur spekulieren beziehungsweise mitteilen, was man vom Hörensagen so weiß. Vor dem geistigen Auge des Lesers entstehen erste Bilder, die den Bau in seinen möglichen Funktionen ausloten: als Zeitkapsel, Arche Noah für Dinge, Speicher, Archiv, Museum.
Im Grundriss erinnert die Architektur entfernt an eine der großen Villen von Frank Lloyd Wright (Abb. 2), ein Gefüge aus ineinandergreifenden, über- und untereinander angeordneten Räumen, ein vergessenes, zweites Fallingwater, das irgendwann im 20. Jahrhundert von seinen Besitzern aufgegeben worden sein mag, zum Schutz gegen die Witterung, gegen Diebe mit Spanplatten vernagelt oder einfach zugemauert. Denkbar wäre auch das Haus eines leidenschaftlichen Sammlers von Jana Gunstheimer, der aus unerfindlichen Gründen das Gebäude verlassen und seine Sammlung zurücklassen musste. Da wir – realistisch gesehen – ohnehin nicht die Gelegenheit haben werden, den Bau im Original zu besichtigen und selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass wir auf ihn stoßen, nicht in sein Inneres werden vordringen können, unternimmt Jana Gunstheimer für ihre Ausstellung den Versuch, das im Buch vorgestellte Raumgefüge des Baus und die Räume der Grafiketage von Museum Morsbroich übereinander zu blenden oder ineinander zu verschränken. Es sind nur Teilflächen, auf denen sich die Räume des ausladenden Baus mit denen der kleineren Museumsetage überschneiden und ausschnitthaft in die Sichtbarkeit der Ausstellung dringen. Man möchte meinen, der durch die Wände der Grafiketage angeschnittene Bau würde hinter diesen weitergehen. Von außen jedoch ist von den Umwälzungen im Inneren nichts zu erkennen.
Im Buch wird mit dem Eintritt in das Gebäude der Erzähler schweigen, nur sporadisch klingen dann noch die von außen an den Bau herangetragenen Spekulationen nach. Die Meta-Ebene einer vagen Führung durch das Gebäude übernehmen nun die architektonischen Grundrisspläne, die Schritt für Schritt, Raum für Raum weiter in das Gebäude hinein und bis an seine entlegensten Stellen reichen. Der große Unterschied zu Kafkas Erzählung ist, dass wir in Gunstheimers Gebäude nicht durch dessen Bewohner geführt werden, nicht dessen intime Einsichten teilen. Wir wissen nicht, ob sich in diesem Bau überhaupt Menschen befinden.
Wollten wir die Künstlerin als Erbauerin annehmen, so scheint sie doch nicht in ihm zu wohnen. Offensichtlich dient (ihr) der Bau als ein Gehäuse für Bilder, das – seiner räumlichen Ausdifferenzierung nach zu schließen – mehr ist als ein bloßes (End-)Lager. Auch wenn das Äußere den Schilderungen zufolge wenig einladend ist, so weckt der komplexe Grundriss doch die Neugierde. Die dort vermerkten Raumbezeichnungen klingen teilweise kryptisch, doch vielversprechend. Mit diesem Plan in der Hand und der Hoffnung, auf zahlreiche, teils unbekannte Werke von Jana Gunstheimer zu treffen, scheint das Wagnis einer Begehung vertretbar – auch wenn wir ahnen, dass unser Bild der Künstlerin danach nicht mehr dasselbe sein wird.
Passage
Was der Plan uns als Eingang zu erkennen gibt, scheint weniger eine Eingangstüre als eine Art Foyer zu sein. Ein Durchgang in dahinterliegende Räume, den man in einer Eingangshalle erwarten würde, ist nicht zu erkennen. Stattdessen ist dort ein einziges Werk angebracht, das den Besucher in Empfang nimmt. In ihm liegt offensichtlich der Schlüssel für den Fortgang der Expedition. Jana Gunstheimer nennt es programmatisch Latent Object(2014) und verweist mit dem Titel auf ein Versteck, auf etwas, das nicht gleich erkennbar ist, potenziell aber noch in Erscheinung tritt. Das Objekt besteht aus einer Leiste linkerhand, die genauso wie der Rahmen rechterhand der Präsentation von Bildern dienen könnte. Der fensterartige Rahmen ist durch eine seitlich verschiebbare Platte verschlossen, die unsichtbar macht, was sich dahinter verbergen mag.
Die Vorrichtung lässt an Fenster denken, wie man sie in historische Eingangstore einließ und die nur von innen zu öffnen waren, um den Einlass zu kontrollieren. Man müsste nur die Klingel (den Türklopfer) finden und warten, bis sich der Verschluss öffnet, damit man einen Blick in den Raum dahinter erhaschen könnte und dann vielleicht auch Eintritt erhalten würde. Die spannungsvolle Erwartung, die Jana Gunstheimer mit diesem Latent Object wie einen Riegel vor den Besuch ihres Gebäudes setzt, sowie der beistehende Text von den … zwei Möglichkeiten … schafft einen Moment des Innehaltens, der Reflexion über das Ansehen wie auch das Machen von Bildern: Solange man das Objekt, die Türe, verschlossen hält, ist der Raum des Bildes offen für alle denkbaren Projektionen. Sobald man aber (als Künstler) Hand anlegt oder (als Betrachter) den Vorhang lüftet und das Bild dem Licht wie auch dem eigenen Blick aussetzt, zwingt man es, Gestalt anzunehmen. Damit erinnert die Apparatur des Objekts aber auch an den Schließmechanismus einer Kamera: Drückt man den Auslöser, so öffnet sich die Klappe und lässt die lichte Außenwelt in das empfindliche Innere der „dunklen Kammer“ (Roland Barthes) ein.Was in die analoge Kamera eindringt, wird von dieser gespiegelt und in einer anderen Form gespeichert, als Negativ, das seinerseits ein latentes, noch unentwickeltes Bild ist.
In diesem Sinne wäre das Gebäude als Speicher, aber auch als Labor vorstellbar, in dem der Prozess der Bildwerdung ermöglicht wird; als verborgenes Reservat, in dem die Bilder sich (weitgehend unbehelligt von Besuchern) unter ihresgleichen befinden und sich in Ruhe entwickeln können – eine Art Spiegelwelt. Sie zu betreten, würde heißen, durch den Spiegel hindurchzugehen, in das Gebäude wie in einen Bildraum einzutauchen und sich mit dem Künstler von der Verpflichtung auf eine außerhalb des Baus herrschende Realität zu befreien.
Latente Bilder
Hat man den Eingang (wie auch immer) passiert, so gelangt man in einen verwaisten Ausstellungsraum, in dem die eigentlichen Exponate nicht (mehr?) vorhanden sind. Nur die von Jana Gunstheimer gezeichneten Sockel (Pale Objects, 2014) stehen da und lassen als Negativform erahnen, was einst auf ihnen geruht haben könnte. Sie erinnern an etwas antiquierte Präsentationsmöbel in archäologischen Museen.
Wurden etwa aus dem mitten im Ausstellungsraum klaffenden, mehrere Stockwerke in die Tiefe des Baus und seiner Geschichte ragenden Loch Skulpturen geborgen und hier ausgestellt? Warum wären sie dann wieder entfernt worden? Weil man vergeblich versuchte, ohne eine Chance…, ihre Geschichte zu ergründen? Weil es wie in Jana Gunstheimers Werkgruppe I have never faced the power(2014) unmöglich war, die zeitliche Distanz zu überbrücken und einen Anblick des Vergangenen zu erlangen, anstatt diesem nur aus der fernen Gegenwart hinterherzusehen? Die detailliert zeichnerisch erfassten Gestalten scheinen zum Greifen nahe, und doch können wir sie nicht dazu bewegen, zum Leben zu erwachen, sich umzudrehen und ihr Gesicht zu zeigen. Beide Werkgruppen weisen auf den Platzhalter, die Fehlstelle, das nicht (mehr) greifbare Gegenstück, welches das Bild komplett machen würde – und damit auf die Notwendigkeit einer Ergänzung, die nun, da die Bilder ihre Gestalt angenommen haben, nur mehr der Betrachter zu leisten vermag. Die Zeichnungen nach antiken Skulpturen wie auch Gunstheimers Pale Objects sind im Kern latente Bilder, insofern jene Gegenstücke in ihnen der Möglichkeit nach vorhanden sind, auch wenn sie nicht in Erscheinung treten.
In ihrer grundsätzlichen Offenheit sind abstrakte Bilder in hohem Maße latent und werden neben noch nicht entwickelten Fotografien und Filmen eigens in einem weiteren Bereich des Gebäudes präsentiert. Ein schwarzes Quadrat (Thank God it‘s Abstract #14, 2013) ruft dort nicht nur den Gründungsakt der gegenstandslosen Malerei ins Gedächtnis. Über eine Landschaft altmeisterlicher Prägung geschoben, verdeckt es in einem halbwegs ikonoklastischen Akt die Bildmitte und damit das ehemals dort angesiedelte Bildgeschehen. Da keine Akteure mehr im Bildraum anwesend sind, fällt das Bild aus dem Rahmen jeder Erzählung. Das Quadrat als abstrakte Setzung fungiert nun wie eine Tabula rasa, die verschiedene mögliche Vorstellungen auf sich zieht, welche in der Fantasie des Betrachters Form annehmen können.
In der gleichnamigen Installation (Thank God it‘s Abstract, 2013) positioniert Jana Gunstheimer zwei Projektoren vor einer Zeichnung, die ein flach liegendes monochromes Bild oder eine leere Leinwand (ein leeres Tablett) vor einer weißen Wand zeigt. Ob die beiden Projektoren (es sind Dummys aus Holz und Pappe) bereits laufen? Vorstellbar wäre, dass sie abstrakte Bilder projizieren oder aber ganz gegensätzliche Bilder, die sich in der Summe aufheben oder als Mehrfachbelichtung so weit aufaddieren, dass davon nur noch eine dünne weiße Linie an der Wand sichtbar ist. Das Ergebnis liegt – der Titel zeigt es an – in Gottes Händen, und hier ist es eben kein Junge, kein Mädchen, sondern abstrakt geworden. Dreifach medial potenziert, weist uns die Künstlerin auf die visionäre, ja metaphysische Dimension der Entstehung eines Bildes aus dem Nichts hin – auch wenn das Bild am Ende ein Fast-Nichts ist. Insofern kann das Thank Godauch ironisch als Dank dafür gelesen werden, dass die Abstraktion den Künstler wie den Betrachter vor den Zumutungen des Gegenständlichen verschont.
Schließlich beinhaltet der Schritt vom latenten zum manifesten Bild immer auch die Möglichkeit des Scheiterns, wovon unterwegs, beim Gang durch das Gebäude, ein Schrank zeugt: Eigentlich würde ein Weg durch ihn hindurch in einen dahinter verborgenen Raum führen. Dieser ist aber nicht mehr begehbar, weil er randvoll ist mit den vielen Absichten, Vorhaben und Entwürfen für Bilder, die sich nicht haben verwirklichen lassen – Projekte, aus deren Planung und Umsetzung die damit Befassten ausgestiegen sind, deren Ausformung und inhaltliche Ausformulierung nicht gelungen ist, weswegen sie verworfen wurden.
Experimente
Im Halbdunkel eines weiteren Raumes ist dagegen noch alles möglich. Diese „Dunkelkammer“ gleicht nicht dem chemischen Labor des Fotografen, sondern vielmehr dem Baukasten eines Architekten, dem Fundus eines Bildhauers, einer Modellbaukammer. Es gibt Fundstücke und zwischengelagerte Materialien; Gunstheimers Zeichnungen geben einen Eindruck, eine Serie partieller Momentaufnahmen Aus Dunkelkammern(2013). Aus dem hier auf Halde liegenden Material werden ganze Bildwelten konstruiert und geordnet, zerlegt und neu aufgebaut oder wieder umgebaut. Hier belauschen wir ein angeleitetes Experiment, eine Art Planspiel: Zwei Probanden, getrieben von infantiler Freude und nur ein wenig geplagt von Gewissensbissen, leben ihre Macht- und Gewaltfantasien aus. Wie einst im Sandkasten erlauben sie sich auch das, was zwar „nicht gut“, aber „lustig“ ist.
Dieser Dunkelraum steht in Gunstheimers Gebäude als Metapher für das Bild als – wie anfangs zitiert – „Möglichkeitsraum“. Mit Einrichtung eines Darkrooms wird – wie auch in anderen Bereichen – durch die Aussetzung der Sichtkontrolle ein Freiraum geschaffen, der ein Handeln außerhalb der Norm ermöglicht. Hier kann sich nach dem Collageprinzip begegnen, was eigentlich nicht zusammengehört. Noch bevor die in der Freizügigkeit eines anything goes entstehenden Bildwelten im Licht der Vernunft und der Kritik bestehen müssen, kann die Künstlerin hier ihrem Trieb folgen, kann die geheimen Freuden des Schöpfertums auskosten und sich der Eigendynamik jenes Experiments hingeben, welches die Herstellung eines Bildes immer auch ist.
Wie in der kleinen Erzählung aus dem Versuchsraum beinhaltet dieses Experiment aber auch die Gefahr der Zerstörung, die Möglichkeit (sie liegt – wie der Stein in der Hand des Sandkastenkindes – in der Macht des Schöpfers) den Prozess umzukehren. In einem Seitengang am linken Rand des Gebäudes finden sich Bilder, an denen sich die latente Gewalttätigkeit des Schöpfers gegen seine eigenen Werke manifestiert. Wenn die Laune umschlägt oder sich im Verlauf von Tagen immer weiter verschlechtert, fliegt auch schon mal die künstlerische Produktion einer ganzen Woche in den Papierkorb. Am Ende des Tages kann der Künstler sich selbst der schärfste Kritiker sein. Und wenn sein Zorn alles, was da entstanden ist, ohne Unterschied verwirft, lässt das tief in die Psyche blicken. Ganz physisch bohrt sich der Dorn der Selbstkritik in die Werke und spießt sie regelrecht auf. Allzu gerne würde man nochmal nachsehen, ob nicht doch einiges Brauchbares darunter war.
Ein weiterer Bereich des Gebäudes ist nur teilweise ausgebaut oder schon wieder teils rückgebaut, ein Raum der Auslöschung. Es wäre denkbar, dass dieser Raum allerlei Instrumente bereithielt oder noch vorhält, um die Zerstörung von Bildern planvoll ins Werk zu setzen. Hier könnten etwa historische Porträtbilder stellvertretend für die in ihnen dargestellten Personen bestraft werden – so wie jener geistesgestörte Attentäter den verhassten Zaren in Ilja Repins Bild Iwan der Schreckliche und sein Sohn Iwan mit einem Messer attackierte, um ihn im Bild umzubringen (Kunsthistoriker sprechen von einem Mord in effigie). Wenn es Jana Gunstheimer war, die in der entsprechenden Zeichnung aus der Serie Methods of Destruction (2011/12)[4]diese fatale Bildverletzung erfand, so sehen wir hier nicht nur, welche zerstörerischen Energien Bilder freisetzen können. Der Raum führt uns auch vor Augen, dass es nicht zuletzt die Künstler selbst sind, deren grundlegende Zweifel am Bild solche Bildwerke, die hinlänglich bekannt und erklärt sind, einer neuen Deutung zuführen können – durch eine Art kathartischen Prozess hindurch, der in der Zerstörung liegt.[5]
Image in Meditation
Ein zentraler Bereich des Gebäudes, an den die anderen Räume sich anlagern, in den sie sich vielleicht auch einlagern oder teilweise mit ihm überlagern, der – je nach Lesart des Grundrisses – möglicherweise ein eigenes Geschoss einnimmt, ist derjenige, der dem Nachdenken der Bilder über sich selbst Raum schafft. Es ist ein Ort der sinnenden Betrachtung, in dem die Bilder ein derart hohes Maß an Reflexionsfähigkeit beweisen, dass der Besucher nur Staunen kann, es ihm die Sprache verschlägt und er eintaucht in eine fast klösterliche Atmosphäre der Meditation. Bei der Betrachtung der Bilder ist es ihm, als könne er ihre Selbstgespräche belauschen, innere Monologe, aus denen ihm Bildtitel zu Ohr gelangen, die einen durchaus bekenntnishaften Charakter haben.
Da gibt es das Bild ohne Eigenschaften (welch desillusionierende Selbsterkenntnis!), es gibt unstetige, schmelzende und entschwebende, aber auch schwergewichtige Bilder, beschlagnahmte, am eigenen Körper bestrafte oder sich selbst zensierende Bilder. Ein Bild gibt die Oberfläche eines anderen wieder, ein weiteres zeigt die Entstehung eines anderen als Vorstellung im Kopf. Eines träumt von Entfaltung und einer Existenz im Dreidimensionalen, während andere in sich gekehrt, geknickt und in Selbstbetrachtung versunkensind. Es wird unterschieden zwischen Schöpfung, Komposition und Kopie. Es begegnen einem glückliche, aber auch aus niederen Beweggründen entstandene und perverse Bilder, zaudernde Exemplare der Gattung Bild und beschämte, die ihre Ecken vors Gesicht klappen.
Alles in allem wirken die Bilder in ihrer Selbstbezüglichkeit sehr menschlich. Sie scheinen sich hier in eine Art Klausur begeben zu haben, wobei sich die einzelnen Werke nicht in mönchische Zellen zurückziehen. Sie sind mit sich selbst beschäftigt, verschließen sich aber nicht. Gerade die Begegnungen in diesem offenen Bereich (im Kloster wäre der Ort dafür wohl der Kreuzgang, ein Wandelgang), der Vergleich und die Selbst-Verortung im Feld der Mit-Bilder scheinen Grundlage jener enormen geistigen Beweglichkeit zu sein, die Jana Gunstheimers Bilder an den Tag legen.
Natürlich geht die Künstlerin diesen Weg der Selbstkritik und Selbstfindung mit ihren Bildern. Sie legt sich in diesen meditativ veranlagten Bildern Resonanzräume an, die der Rücksprache mit dem eigenen Werk dienen, wie dies letztlich auch das gesamte Gebäude tut: ein Konglomerat von Räumen, in denen Jana Gunstheimer über die Bedingungen der Entstehung und Deutung von Kunst meditiert. In ihrer Gesprächigkeit wirken die Bilder wie Patienten, die sich vor ihrer Schöpferin auf die Couch legen. Indirekt gewährt ihre schonungslose Selbstanalyse dem Betrachter aber auch Innenansichten der Künstlerin bei der Arbeit. Es sind Psychogramme des von Zweifeln und widerstreitenden Emotionen begleiteten Werkprozesses, des Ringens mit den zahllosen Möglichkeiten, die sich bieten, und mit Optionen auf Auswege aus dem Korsett der Ansprüche, die von allen Seiten an das Bild herangetragen werden.
Baustelle
Wo der Weg nicht zu einem befriedigenden Ergebnis, die Meditation nicht zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit führt, drohen Schlafstörungen – ein Zustand, der die Künstlerin auch bei der Konstruktion dieses Baus geplagt haben könnte. Auch wenn sie sich diszipliniert und neben der Arbeit im Drawing Room noch eine 40-Stunden-Woche im Office absolviert, wird dieses Gebäude nie fertig sein, schon aus Prinzip. Immer gibt es einen oder mehrere Räume, die sich Under Construction befinden, stehen Erweiterungen, Umgestaltungen und Renovierungen an. Der Bau bleibt Baustelle, wie auch die vielen latenten Bilder weiterhin auf Klärung warten, die Ideen auf Umsetzung, die Entwürfe auf Verwirklichung. Wie soll man da zur Ruhe kommen?
Man mag in Gunstheimers Sleepless Image(2015) das Schlafzimmer Georg Muches in den Dessauer Meisterhäusern wiedererkennen. Diese Identifizierung ist aber nebensächlich, da das Bild an eine ganz allgemeine Erfahrung rührt, die jeder, zumindest jeder Künstler, schon gemacht hat: In schlaflosen Nächten bildet sich zwischen den vier Wänden der Kammer ein Raum aus, der die unterschiedlichsten Einbildungen auf sich zieht, in dem mitunter Traum- und Wachzustand schwer zu unterscheiden sind. Wenn in das gezeichnete, ansonsten leere Zimmer zahlreiche Bilder drängen, die sich in der Art von Pop-up-Fenstern öffnen, verlässt die Darstellung offensichtlich das bloße Abbild eines realen Raums. Anders als die auf Wänden und Boden perspektivisch verzerrten und atmosphärisch verunklärten Lichtreflexe stehen diese abstrakten Platzhalter für die Projektionen, die sich vor dem geistigen Auge zeigen.
Wir blicken in ein Zimmer und zugleich in das Gehirn einer Person im geistigen Unruhestand. Es ist naheliegend, in dieser Person auch die Künstlerin selbst zu suchen. Sie könnte oder sollte hier liegen und schlafen, doch es arbeitet in ihr, wie es auch unentwegt in dem Bau arbeitet. Das Schlafzimmer erscheint in Gunstheimers Zeichnung als Baustelle, der Bau seinerseits bietet mehr Raum für das Nachdenken und Experimentieren als für eine Auszeit. Wie jedes Werk eines Künstlers potenziell auch über ihn selbst spricht, sein Œuvre damit als die Summe seiner Selbstzeugnisse zu verstehen ist, so ist dieser Bau als indirektes Porträt der Künstlerin zu lesen. Er ist eine Art verräumlichte und teilanimierte Werkbiografie der letzten fünf Jahre – animiert, da sich in dem Gebäude nicht nur die Künstlerin als unermüdliche Architektin auslebt, sondern auch ihre Werke sich entfalten, als wären sie die eigentlichen Bewohner. Einen solchen Bau zu errichten, kann zur Lebensaufgabe werden. Auf dem Weg dorthin: Image[s] of a Latent House; in einem Buch, einer Ausstellung: work in progress.
[1]Das „Wiedersehen der alten Wohnung“, die „lange Wanderung durch die Gänge, […] das ist ein Plaudern mit Freunden“. Kafka, Franz: Der Bau, 1923/24, zuerst 1931 hrsg. von Max Brod; im Volltext zugreifbar unter: http://gutenberg.spiegel.de/buch/der-bau-160/1.
[2]Gunstheimer, Jana: Irrige Vorstellungen kausaler Zusammenhänge. Vortrag anlässlich des SymposionsZeichnen als Erkenntnis, Akademie der Bildenden Künste München 2013; Video abrufbar unter http://www.zeichnen-als-erkenntnis.eu/.[3]Cixous, Hélène:Die unendliche Zirkulation des Begehrens. Weiblichkeit in der Schrift, Berlin 1977;zit. nach Berning, Johannes: Schreiben als Wahrnehmungs- und Denkhilfe. Elemente einer holistischenSchreibpädagogik, Münster 2002, S. 24.[4]Die Zeichnungsserie Methods of Destruction(2011/12) dokumentiert akribisch verschiedenste Attacken, die gegen bestehende Kunstwerke, häufig bekannte museale Meisterwerke, geführt wurden. Die Beschädigungen sind fiktiv, und doch simuliert sie die Künstlerin in einem „mimetischen Akt“ , indem sie die Zerstörungen jeweils am dargestellten Bild (nach-)vollzieht: Historische Werke werden ausradiert, zerschnitten, durchstochen oder beschossen, die Motive der Täter in beistehenden Texten erläutert; vgl. hierzu Kröner, Magdalena: Zerstörung als Modus im Werk von Jana Gunstheimer, in: Jana Gunstheimer. Methods of Destruction,hrsg. von Galerie Conrads, Düsseldorf, Galerie Römerapotheke, Zürich; Berlin 2012, S. 8–15, zit. S. 9.
[5]Kröner 2012 (wie Anm. 4), S. 10 f., zufolge verhandle die Künstlerin „die Zerstörung eines Bildes als Akt des Begehrens und Ausdruck des Wunsches nach Inbesitznahme“. Die fiktive Beschädigung offenbare „Leerstellen der Rezeption“ und führe stark auratisierte und in ihrer Deutung festgelegte Werke erneut dem Diskurs zu.
Bilder werden zerstört, seit sie existieren: spektakuläre Angriffe auf Bilder hat es in der Geschichte der Malerei immer gegeben, und nur wenige Schlagzeilen reichen aus, um sie im kollektiven Gedächtnis wachzurufen: 1959 kam es in der Münchener Alten Pinakothek zu einem Säure-Anschlag auf Rubens „Höllensturz der Verdammten“, 1975 ereignete sich eine Messerattacke auf Rembrandts „Nachtwache“ im Amsterdamer Rijksmuseum, 1982 schlug ein Student „aus Angst vor dem Bild“ mit einem Rohr in der Berliner Neuen Nationalgalerie auf Barnett Newmans „Wer hat Angst vor Rot, Gelb und, Blau“ ein.
Die Zerstörung von Bildern folgt – betrachtet man historische Bilderstürme – häufig pathologischen, jedoch auch politischen, religiösen und ideologischen Gründen. Ferner wurden und werden sie als Akt der Zensur systematisch von totalitären Regimes eingesetzt. Dass die Beschäftigung mit der Zerstörung eines Bildes aber nach wie vor auch als Modus bildkünstlerischen Handelns relevant sein kann, führt Jana Gunstheimer in ihrem zeichnerischen Werk vor. Dabei stehen nicht ästhetische Veränderungen im Vordergrund, die auf eine formale Erweiterung des Dargestellten abzielen. Vielmehr überführt Jana Gunstheimer in einem mimetischen Akt die Simulation mutwilliger Zerstörungen wie Schnitte und Kratzer ebenso wie blinde Flecken und Leerstellen in historische und selbstgewählte Bildvorlagen.
Zerstörung als Wechsel des Aggregatzustandes: Methods of Destruction
„…was hier zu sehen ist, gilt (…) als Indiz der (…) überlegten Zerstörung von Dokumenten, also einer virtuellen, vergangenen Beweiskraft erster Ordnung, die durch eine solche Dokumentation der Zerstörung nicht verfällt, sondern gewissermaßen den Aggregatzustand wechselt. Sie wird auratisiert und steht nun anderen, auch ästhetischen Lektüren und Betrachtungen offen.“
Was der Kulturwissenschaftler Tom Holert in Bezug auf ein Nachrichtenbild militärisch relevanter, im Irakkrieg zerstörter Beweismittel zur Waffenproduktion beschreibt, lässt sich auch auf die Arbeiten Jana Gunstheimers übertragen, jedoch mit einer grundlegenden Verschiebung, denn die ausgedachten Zerstörungen beziehen sich nicht auf faktische Dokumente, sondern auf berühmte Gemälde wie Francisco de Goyas „Erschießung der Aufständischen“, Anselm Feuerbachs „Lucrezia Borgia“ oder François Bouchers „Braune Odaliske“. Jana Gunstheimer bezieht sich auf bereits existierende Schöpfungen anderer Künstler und konfrontiert diese mit eigenen, wiederum erfundenen Bildverletzungen. Diese fiktiven Attacken aufs Bild führen so den Prozess der Auratisierung entlang einer doppelten Spur. Gunstheimer operiert mit einer auf Fiktionalisierung beruhenden Dopplung, die eine Vielzahl ebenso absurder wie paradoxer Anteile enthält. Im Wechselspiel von Text und Bild, von Aura, Narration, Fiktion und Zerstörung offenbaren sich Leerstellen der Rezeption. Ein zusätzlich eingebundenes formales Gerüst, das sich auf Modi musealer Archivierung stützt, verstärkt dabei noch die Glaubwürdigkeit der Fiktion. Die Kunstwerke werden zunächst durch den Prozess des Zeichnens abstrahiert und danach in Archivmappen zusammengefasst, die das beschädigte Bild zu enthalten scheinen und mit einem erläuternden, sachlichen Begleittext versehen sind. Diese Wissenschaftlichkeit und empirische Effizienz suggerierende Art der Präsentation verweist, wie in allen Arbeiten Jana Gunstheimers, auf eine übergeordnete Instanz, die sich mit den behandelten Sachverhalten beschäftigt und diese bearbeitet. Die ausgedachten und gleichwohl überzeugend präsentierten Beschädigungen der Kunstwerke und ihre anschließende Verwaltung, hier mit verblüffender Kohärenz vorgeführt, reinigt diese schockartig von den Schichten kunsthistorischer Auratisierung und interpretatorischer Patina. So bewirkt die Zerstörung als inhaltlicher und formaler Modus Operandi zweierlei: Sie führt zu einer Wiederbelebung des tatsächlich existierenden Werkes und ermöglicht darüber hinaus eine komplexe Reflexion des Faktors Bildzerstörung in der Kunstgeschichte. Durch Gunstheimers Methoden der Zerstörung lassen sich neue, durch eine idolatrische Rezeption bislang überlagerte Gehalte formulieren und reflektieren.
Gleichwohl formulieren diese Arbeiten weniger die Aussicht auf Katharsis denn einen grundlegenden Zweifel an jedem der gezeigten Motive. Das Bild wird einer erfundenen Attacke unterzogen. Es wird, folgt man der Unterscheidung des Philosophen Vilém Flussers, nicht zerstört, sondern destruiert: „‚Zerstörung‘ und ‚Destruktion‘ meinen nicht genau dasselbe (…). ‚Destruktion‘ meint eher Abbau und Entstellung als Zerstörung, und ‚Zerstörung‘ eher Desobstruktion als Destruktion. Denn ‚Zerstörung‘ verneint das Stören und ‚Destruktion‘ das Stellen. (…) ‚Destruieren‘ heißt Regeln abschaffen, wonach sich Dinge ordnen, so daß diese Dinge auseinanderfallen.“
Das Aufheben der Regeln, das Jana Gunstheimer in den von ihr destruierten Werken praktiziert, wirft den Betrachter zurück auf sich selbst. Er wird in ein Zwischenreich aus Fakt und Fake gestoßen, in dem sich eine Vielzahl von Ambivalenzen regen. Zusammengehalten wird dieses Konvolut so unterschiedlicher Kunstwerke aus verschiedenen Epochen von einer in der Realität wurzelnden, möglichen Geschichte der Bildzerstörung: alles hätte sich so ereignen können, aber vielleicht auch ganz anders – oder gar nicht. Von hier aus erörtert Jana Gunstheimer zudem komplexe medien- und wahrnehmungstheoretische Fragen: Wie ist es möglich, falsche Informationen zu verbreiten, die als wahr hingenommen werden? Welche neuen Kontexte ergeben sich aus den hier skizzierten, absurden Szenarien?
Die Künstlerin geht noch einen Schritt weiter, indem sie die Zerstörung eines Bildes als Akt des Begehrens und Ausdruck des Wunsches nach Inbesitznahme verhandelt. Der simulierte Angriff, den die Künstlerin ins Zentrum ihres bildkünstlerischen Handelns stellt, ermöglicht auf vielfältige Weise ein erneuertes Eintreten des überdeterminierten Kunstwerkes in den Diskurs. Ihre zeichnerischen Attacken destruieren und konstituieren das Bild gleichermaßen, machen also über den primär wahrnehmbaren, destruktiven Akt hinaus etwas anderes sichtbar. Das von Gunstheimer geschaffene Bild ist dabei zugleich authentisch und ein Simulakrum; es ist in der Welt und ahmt die es umgebende Realität nach, es ist authentisch und verweist doch stets auf ein Werk außerhalb und gegenüber seiner selbst, es ist Original und Kopie, selbstreflexiv und transzendent.
Kirche, Psychose und Blinder Fleck: „Eiskaltes Licht“
„Wie ein schwankendes Schiff sei es gewesen, sagt man, und sie hätten auf die andere Seite laufen müssen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ganz unheimlich sei ihnen gewesen und einige hätten gemeint, die Welt gerate aus den Fugen."
Das Nachdenken über Emphase, Reinigung und transformatorische Erlösung des Motivs rückt unweigerlich Jana Gunstheimers Bildserie "Eiskaltes Licht (wie von Totenkerzen)" ins Blickfeld. Als Stipendiatin der Villa Massimo im Jahr 2010 hat sie sich in Rom katholischen Kirchen zugewandt. "Eiskaltes Licht" illustriert mittels Ansichten von Kircheninnenräumen wie Santa Maria Immacolata, San Clemente Al Laterano oder Il Gesù (fiktive) unerklärliche Erscheinungen und bedrohliche Visionen, die Besucher dort erlebt haben. Im Begleittext fügt sie (im Namen des Psychoanalytikers A. P. Pezzella) hinzu, „die Visionen seien auf Repressionen der katholischen Kirche zurückzuführen, die vermehrt zu Angstzuständen bei Gemeindemitgliedern führten“. Die bildliche Entsprechung findet der religiöse Wahn in der Visualisierung bedrohlicher Worte, blinder Flecken, heller Aureolen oder einem opaken Dunkel. Das Verdrängte und die aus dem Verbot entspringende Psychose sickern ins Bildgefüge ein.
In dieser Bildserie erfüllt der blinde Fleck im Bildgefüge andere Funktionen als in „Methods of Destruction“: Er verweist auf das Irrationale im Glauben, aber ebenso auf Zerstörung als Mittel institutionalisierter Machtausübung der katholischen Kirche. Die Geschichte des Katholizismus zeigt sich, beginnend mit der Inquisition, als ein Ringen um Deutungshoheit und um semantische Verfügungsgewalt als Äquivalente weltlicher Herrschaftsansprüche. Kaum ein historisches Monument zeigt den Zerstörungs- und Machtwillen der katholischen Kirche wohl so deutlich wie die Mezquita-Kathedrale im andalusischen Córdoba, wo die maurische Moschee im Jahr 1236 nach der erneuten Machtübernahme durch die Katholiken nicht geschliffen, sondern erhalten und zur christlichen Kirche geweiht wurde. Als Zeichen der Machtübernahme baute man später mitten in die ehemalige Bethalle der Moschee eine Kathedrale im plateresken Stil mit einem Hochaltar, der in seiner ornamentalen Opulenz keinen größeren Kontrast zur Ästhetik der islamisch geprägten Umgebung bilden könnte.
Ästhetisches Handeln als unmittelbarer Ausdruck faktischer Macht prägt auch die katholischen Kirchen Roms, in denen Jana Gunstheimer für „Eiskaltes Licht“ gezeichnet hat. In dieser Bildserie muss der Betrachter den eigenen Glauben anstelle von faktischem Wissen und empirischer Erkenntnis setzen; er ist gezwungen, der Künstlerin ihre Behauptungen zu glauben, ebenso wie ein Gläubiger gezwungen ist, die Lehren der Kirche zu glauben. Auch in dieser Bildserie evoziert die Zerstörung beziehungsweise die Auslöschung eine doppelte inhaltliche Spur: die Behauptungen von Bild und Kirche fallen zusammen und ziehen sich gegenseitig in Zweifel. Gunstheimers Motive konstituieren ihre Präsenz im Spannungsfeld zwischen Empirie und Erfindung, Glauben und Irrationalität, der Aura eines Kunstwerkes und dessen (Zer)Störung. In ihrem Werk konstruiert Jana Gunstheimer Ketten scheinbar schlüssiger Indizien, die ins Nichts weisen, deren Verführungskraft und innere Logik jedoch so kohärent sind, dass die Täuschung gelingt.
Die falschen Fährten werden in aufklärerischer Absicht gelegt: Jana Gunsteimer schafft in ihrem zeichnerischen Werk ambivalente Bildräume, die sich vermittels ihrer Beschädigung oder Irritation in den Umraum eintragen und zugleich eine Spur des Erinnerns ins Unbewusste und Ungeklärte legen. Das Augenfälligste ist dabei die sichtbar gemachte Spur der Zerstörung, die Wirkung zeigt, auch wenn sie als Fiktion offenbar wird. Die sich physisch mitteilende Präsenz der gewaltsamen Geste und des Rätselhaften, Irrationalen im Bild bezieht sich unmittelbar auf das Motiv, verweist aber zugleich auf eine Realität außerhalb davon. Die Freiheit zu entscheiden, was in diesen Bildern stimmen mag, was richtig ist oder logisch, gibt Jana Gunstheimer ihrem Publikum mit ihren täuschend echten Fiktionen kaum vor. Wohl aber lässt sie einem sehr aufgeweckten Betrachter die Möglichkeit offen, die Unwahrscheinlichkeiten darin aufzuspüren.
Peter Handke, Der Bildverlust, Frankfurt am Main, 2003.
Ingeborg Ruthe, „Alle Stile sollen brennen“, in: Berliner Zeitung, 6. September 2000.
Marcel Struwe, "Nationalsozialistischer Bildersturm. Funktion eines Begriffs," in: Martin Warnke (Hg.), Bildersturm. Die Zerstörung des Kunstwerks, München, 1973, S. 121–140.
Hinweise auf jüngere Ikonoklasmen (Bilderstürmereien) wie in China, Haiti, Nicaragua oder Korea sind im Kapitel „Außerhalb der ersten Welt“ nachzulesen. Vgl. Dario Gamboni, Zerstörte Kunst, Bildersturm und Vandalismus im 20. Jahrhundert, Köln 1998, S. 111 ff.
Klaus Hoffmann schlägt eine nach Künstlern und Verfahrensweisen geordnete Liste künstlerischer „Destruktions-Verfahren“ vor. Aufgeführt werden unter anderem „Ablösung, Zerreißung, Verräucherung, Knitterung, Siegelung, Einpackung, Besudelung, Tröpfelung…“. In: Klaus Hoffmann, Kunst-im-Kopf, Aspekte der Realkunst, Köln 1972.
Tom Holert, Regieren im Bildraum, Berlin 2008, S. 105.
Vilém Flusser, Gesten. Versuch einer Phänomenologie, Düsseldorf/Bensheim 1991, S. 100 ff.
Jana Gunstheimer, Begleittext zur Arbeit Santa Maria Immacolata.
So leicht ist heute niemand mehr geschockt. Und nur wenig kann uns Menschen des 21. Jahrhunderts noch erstaunen. Dauerinformiert durch sprach- und bildgewaltige Medien erfahren wir tagtäglich von neuen Rekorden, Katastrophen und persönlichen Schicksalen. Wir erleben, welche Mutationen unser gesellschaftliches Miteinander durchläuft und in welch abstrusen Verirrungen sich die heutige Gesellschaft häufig bewegt. Besonders angesagt in dieser allgegenwärtigen Mitteilungsflut sind neben den großen weltpolitischen Themen vor allem private Innenansichten: Mit einer Mischung aus Voyeurismus und Übersättigung verfolgen wir politische oder persönliche Entscheidungen, sehen Menschen am sozialen Abgrund oder auf dem Höhepunkt selbstdarstellerischen Produzierens.
Was ist also so ungewöhnlich an einer Geschichte, in der Menschen die Möglichkeit erhalten, zu Lebzeiten heilig gesprochen zu werden? So dass sie noch selber erleben können, ein Volks- oder Nationalheld zu sein? Die Idee ist so verlockend, dass manche Glaubensgemeinschaft neidisch werden könnte.
In ihrer Arbeit „Heiligsprechung“ stellt Jana Gunstheimer knapp, informativ und sachlich die Idee der österreichischen Bundesregierung vor, eine „Staatliche Behörde zur Kanonisation“ einzurichten. Dass die 1976 geplante und bereits 1981 wieder geschlossene Behörde letztlich den Bürgern nur das Geld aus der Tasche ziehen wollte – denn jeder Antragsteller musste für die Bewerbung tief in den eigenen Geldbeutel greifen – und es außerdem auf die privaten Enthüllungen der Bürger abgesehen hatte: Solche behördlichen Hintergedanken klingen vertraut und verwundern ebenso wenig wie der Umstand, dass trotz 8625 eingegangener Anträge lediglich drei Personen die Heiligsprechung erlangten.
Was für eine Geschichte, denkt man und amüsiert sich insgeheim über die Eitelkeit und Dummheit der Anderen, in diesem Fall der Österreicher. Und so bereitet das Lesen dieser einfallsreichen und humorvollen Schilderungen ebensoviel Freude wie das Betrachten der dazugehörigen Exponate: Es eröffnet sich ein Archiv, das bestückt ist mit scheinbar wissenschaftlich verfassten Texten, feinen Scherenschnitten, täuschend echt gezeichneten Zeitungsberichten und in altmeisterlicher Manier gemalten, an alte Fotografien erinnernden schwarz/weißen Aquarellen. Dazu gesellen sich absonderliche, faszinierende und abstoßende Objekte und Modelle, etwa ein aufgehängtes und geöffnetes Schaf aus (Fell, Pappe, Stoff und Farbe) – installativ zusammengefügte Elemente, die direkt aus einer Wunderkammer zu stammen scheinen. Dies alles dient der verdichtenden Bebilderung und beglaubigenden Dokumentation einer grandios erdachten Fiktion, die in ihrem Detailreichtum frappierend plausibel erscheint und so unterhaltsam wie insgesamt sympathisch ist.
Themenwechsel: Der Titel klingt ernüchternd und desillusionierend: „F. macht den ersten falschen Schritt.“ Das scheint nichts Gutes für die Zukunft zu verheißen. Liegt es daran, dass F. beengt lebt, wie ein anderer Titel konstatiert? Das fatale Ende kommt jedenfalls nicht überraschend: „In diesem Haus vergaß man F.“ Diese knapp formulierten Überschriften sind nicht der Bildzeitung entnommen, sondern der seit zwei Jahren regelmäßig erscheinenden Zeitung „Maßnahme“, publiziert von NOVA PORTA, einer von Jana Gunstheimer vor einigen Jahren gegründeten Organisation „zur Bewältigung von Risiken“. Die Künstlerin gibt sich hier als Mitherausgeberin dieser Zeitung zu erkennen.
Mit real erscheinenden Berichten und vermeintlichen Fotos, bei denen es sich um Reproduktionen von Aquarellen handelt, nimmt man Anteil am Schicksal jenes Unbekannten. Das Kürzel F. steht hier für eine Person, die vollständig katalogisiert erscheint, über die vieles berichtet wurde, die aber gerade aufgrund der nur vordergründig informativen Texte vage und wenig greifbar bleibt. Auch wegen des Kürzels, das anstelle eines Namens steht, erinnert die Figur des F. an Protagonisten aus Franz Kafkas literarischem Albtraum-Kosmos. Aber wer ist F.? Ist er Insasse einer Anstalt, wo er von seinen Betreuern ständig beobachtet wird, z.B. genau dabei, wie er mit dem heutigen Überangebot an Mitteilungen und medialen Berichten umgeht?
„F.’s liebste Vorstellung: In seinem Zimmer hockend tapeziert er die Wände mit all den Zeitungen, die ihn täglich überschwemmen. So lange, bis er gerade noch Platz für sich hat. So sitzt er inmitten des Weltgeschehens und muss doch nichts tun“.
Dieser Text entstammt einem panoramaartig über die Wand laufenden Leinwandstreifen, auf dem in Gestalt von aneinander gereihten Karteikarten kurze Texte mit Scherenschnitten und Aquarellen alternieren.
F. steht dabei nicht nur für eine Anonymisierung und Allgemeingültigkeit seiner Erlebnisse, sondern ist auch ein weiteres Indiz für Jana Gunstheimers Vorliebe für Abkürzungen, die sich durch ihre gesamte Arbeit ziehen: Die bereits erwähnte SBK steht für Staatliche Behörde für Kanonisation, die PoAs sind Personen ohne Aufgabe, die unsere geordneten gesellschaftlichen Abläufe gefährden.
Auch Jana Gunstheimers neue, für das Kunstmuseum Bonn entwickelte Arbeit, die bei Redaktionsschluss lediglich als mündliche und schriftliche Beschreibung der Künstlerin vorlag, thematisiert die Medien und ihren Einfluss auf die Öffentlichkeit und den Einzelnen.
Die in zwei Teile gegliederte Arbeit mit dem Titel 'Genie' verweist zum einen auf das Phänomen einer außergewöhnlichen Begabung. Zum anderen liegt die Assoziation mit dem 1970 in Los Angeles entdeckten, so genannten Wolfskind namens Genie nahe. Dieses Kind verbrachte seine Kindheit festgeschnallt auf einem Stuhl, konnte nicht sprechen, kaum laufen und reagierte auf seine Umwelt nur schwach. Das Wolfskind mit seinem an Kaspar Hauser erinnernden Schicksal wurde nach seiner Entdeckung unzähligen psychologischen Tests und Behandlungen unterzogen, die jedoch keinerlei Wirkung zeigten.
Jana Gunstheimer betont ausdrücklich, dass ihre Arbeit sich auf keine der beiden Verweise unmittelbar festlegen lässt. Entscheidend für die Künstlerin ist das diffus unbehagliche Gefühl, das diese Geschichte beim Leser auslöst. Denn an keiner Stelle erfährt man, um was für eine Art von Mensch es sich bei ‚Genie’ handelt, es gibt lediglich Hinweise auf außergewöhnliche Fähigkeiten wie auch auf ein völlig gestörtes Verhalten.
Im ersten Teil der Arbeit, der im großen Raum des Kunstmuseums gezeigt wird, ist an einer Wand die fragmentarische Beschreibung einer Talkshow zu lesen. Das 'Genie' wird hereingeführt, und es wird sofort überdeutlich, dass es sich bei diesem Wesen um das Opfer einer furchtbaren Tat handeln muss. Dennoch wirkt das 'Opfer' erstaunlicherweise nicht so, wie man es von ihm als leidender oder gar gebrochener Persönlichkeit erwartet. Es läuft gebeugt, in seinem Gang liegt etwas zugleich Monströses und Unbeholfenes, und die ganze Erscheinung hat etwas Brutales, ja Verschlagenes an sich. Die mitfühlenden Fragen der Moderatorin ignoriert das 'Genie' zuerst, später geht es dazu über, sie unverschämt grinsend anzustarren. Eine Sammlung von Studien aus der Verhaltenspsychologie und 2-3 große Aquarelle ergänzen dieses Fragment.
Der zweite Teil der Arbeit besteht aus einer Plattform, von der aus man auf ein sehr sorgfältig eingezäuntes Areal blickt, das einem Gatter im Zoo ebenso ähnelt wie einer Versuchsstation für zwischenmenschliche Beziehungen. Hier scheint sich das ‚Opfer’ aufzuhalten und als Besucher hat man die Gelegenheit, aus sicherer Distanz zu beobachten, wie sich jemand verhält, der die Regeln unserer Gesellschaft erst noch erlernen muß.
So unterschiedlich Jana Gunstheimers Arbeiten auch erscheinen, thematisieren sie doch immer wieder dieselben Beobachtungen und Mechanismen, die als Grundlage ihrer Werke dienen: die Medien und die Rolle, die sie in unserer Gesellschaft spielen, sowie die Verschränkung von Privatheit und Öffentlichkeit. Konkret kann sich dies im Werk der Künstlerin auch in Aktionen der Besetzung und der Machtergreifung äußern, in denen unterschiedliche soziale Schichten aufeinanderprallen – wie etwa die geheimnisvollen Vorgänge und das nächtliche Unwesen, das die PoAs in der Villa Hügel, dem ehemaligen Sitz der Familie Krupp, treiben. Aufgrund ihrer Nachvollziehbarkeit und Glaubwürdigkeit spielen Gunstheimers Arbeiten stets mit möglichen Realitäten, indem sie geschickt aktuelle Ereignisse aufgreifen und diese mit frappierender Logik ins Reich des Erfundenen weiterspinnen. In der Komplexität der Darstellungsebenen, auf denen sich Dokumentarisches mit Halbwahrem und Erfundenem mischt, stoßen archaisches Dorfleben, Dialekt und Aberglauben, Tradition und Volkskunst schroff auf die von Medien und Technik dominierte Realität des 21. Jahrhunderts.
Dabei nutzt Gunstheimer die Mittel der Ironie und des schwarzen Humors in einer solch feinen Dosierung, dass Fiktion und Erdachtes nicht unmittelbar sichtbar werden, sondern als brilliante künstlerische Formulierungen in diesem Spiel mit Absurditäten irritieren und amüsieren.
„Maßnahme zur Bewältigung von Risiken – ein befristetes Zeitungsprojekt von Jana Gunstheimer. NOVA PORTA ist eine Organisation zur Bewältigung von Risiken, die sich vornehmlich an arbeits- und antriebslose Jugendliche wendet. Diese sollen in fragwürdigen Weiterbildungsveranstaltungen sinnentleerten Trainings-Programmen und groß angelegten Feldforschungen fit gemacht werden für eine Zukunft, in der zur Gefahr wird, wer keine Aufgabe hat. Ursprünglich als fiktives Projekt gedacht, besteht seit seiner Gründung im Jahr 2003 gleichzeitig die Möglichkeit, Mitglied von NOVA PORTA zu werden. Interessenten können Beitrittsformulare ausfüllen bzw. sich auf der Website www.nova-porta.org um eine Mitgliedschaft bewerben. Seither hat sich so eine Vielzahl von Bewerbern angemeldet, von denen einige tatsächlich arbeitslos sind.“
Von der Malerei geht eine Macht aus, die weit über die Sphäre der Kunst hinausreicht. Wenn ihre Symbolkraft zu groß wird und das regierende politische, religiöse oder sonst wie ideologische Programm stört, greifen die Menschen deshalb zu drastischen Mitteln – Ikonoklasmus, Bildersturm und Zerstörung. Bei der Kunst hat man es manchmal nämlich nicht nur mit einem Schattenreich der Wirklichkeit zu tun, das auf einfache Weise der realen Welt gegenübersteht. Die Kunst vermag vielmehr die Gegenüberstellung dieser Welten aus dem Gleichgewicht geraten und ineinander zu gleiten lassen. Am Ende ragt der Schatten der Kunst dann selbst noch in die lebendige Form hinein.
Wenn Bilder und das von ihnen Repräsentierte solchermaßen symbolisch in eins fallen, wird die Repräsentation zum Doppelgänger des Wirklichen, zum Wiedergänger und unheimlichen Double. Dann ist die Wirklichkeit im Bild nicht aufgehoben, sondern seltsam verschoben und verwandelt. Was sich in simpler Weise hätte identifizieren, benennen und kategorisieren lassen, wird sich selbst unähnlich, denn in ihrer Ähnlichkeit vermag die Kunst jene Kategorien, die zwischen Modell und Kopie trennen, souverän zum Einsturz zu bringen.
Jana Gunstheimers Serie Methods of Destruction nimmt sich dieser unheimlichen Macht der Bilder an und dokumentiert scheinbar historische Präzedenzfälle symbolischer Zerstörungen von Gemälden und Zeichnungen. Paradoxerweise verleihen jedoch ihre wie inventarisierte Buchseiten angelegten Zeichnungen der erläuternden Geschichte erst jene visuelle Evidenz, die letztlich nur vorgetäuscht ist. Der destruktive Akt bleibt Fiktion: die Zeichnung von Paul Klee ist noch intakt, Feuerbachs Nanna als Virginia unbeschädigt. In dem eloquenten Diskurs über die Möglichkeiten, durch Modifikationen oder Verletzungen von Werken der Kunst letztlich auch die Wirklichkeit nicht nur symbolisch, sondern faktisch zu verändern, säen diese Arbeiten jedoch genau jenen Zweifel, der das Behauptete in den Bereich des Möglichen überführt. Einmal ausgesprochen, eröffnen sich Wege, die staunen machen, dass die Zerstörungsakte gar nicht stattgefunden haben. In Gunstheimers Szenarien haben sich die Kategorien nämlich bereits verschoben, der Sinn ist zwischen Realität und Fiktion, realer Welt und Repräsentation ins Schwanken geraten. Praktisch richtet sich die Schändung von Bildern gegen diese, eigentlich aber gegen ihre Produzenten oder die dargestellte Person. Die executio in effigie, die stellvertretende Exekution, nimmt das Bild tatsächlich als Doppelgänger des Porträtierten wahr, auf ewig mit diesem verbunden. Auch das zum Zweck amouröser Verehrung aus einem Gemälde Bouchers herausgeschnittene Hinterteil eines weiblichen Modells fetischisiert dieses als Widergängerin des abwesenden Originals. Moderne Fallbeispiele, die Gunstheimer in ihren überaus realistischen Zeichnungen in das Reich fiktiver Tatsächlichkeit überführt, verstehen sich als erzieherische Maßnahme, wenn etwa ein weiblicher Akt Picassos „verschlankt“ wird, um dem zeitgenössischen Körperkult kein negatives Ideal zumuten zu müssen. Aus welchem Schattenreich der Geschichte diese Bilder aufgetaucht sind, diese methodisch manipulierten Doubles der Wirklichkeit, verbleibt am Ende jedoch spekulativ.
Jana Gunstheimers Genie (Labor) wurde 2008 erstmals in der Kunsthalle Bonn gezeigt und nun für District als permanente Installation in den ehemaligen Räumen des technischen Diensts der historischen Malzfabrik weiterentwickelt. Wo sich bis 1996 das operative Gehirn, Kontrollzentrum und Wartungskommando der Brauerei befand, hat die Künstlerin ein düsteres Labor mit Überwachungsplattform für ein abwesendes Genie geschaffen. Der verwildernde Protagonist dieses Ortes, der Gefängnis und Bühne zugleich darstellt, ist Gunstheimers Phantasiefigur Herr Wosche.
Herr Wosche, so erfahren wir aus den anderen Werken der Serie „Genie“ (2008), befindet sich auf dem Weg der Transformation in eine tierische Daseinsform: Während sein Körper unaufhörlich wächst, verlernt er die menschliche Sprache und weigert sich, den Normen des sozialen Umgangs weiter zu folgen. In der Figur des „Genies“ Herrn Wosche verbindet Gunstheimer den Mythos einzigartiger geistiger Fähigkeiten mit den Symptomen so genannter Wolfskinder, die isoliert von anderen Menschen unter Tieren oder in grausamer Gefangenschaft aufwuchsen. Von jeher bildeten Wolfskinder, wie Kaspar Hauser oder das 1970 in Los Angeles entdeckte Mädchen Genie, eine Projektionsfläche westlicher Gesellschaften und gingen als wissenschaftlicher wie auch literarischer Untersuchungsgegenstand in das kollektive Gedächtnis ein. Diese „Wilden“ aus der eigenen „zivilisierten“ Mitte verkörperten das Bild des „Anderen“, das mit den zeitgenössischen Exorzismen der Aufklärung und der Psychiatrie diszipliniert und dominiert wurde.
In der scheinbar selbst gewählten Verwilderung und Isolation des Herrn Wosche findet eine ebenfalls umgekehrte Wolfskind-Figur der Moderne ihren Widerklang: In seiner Erzählung Bartleby, the Scrivener: A Story of Wall Street von 1853 schildert Herman Melville die Entwicklung des Büroangestellten Bartleby, der sich im Laufe der Geschichte zusehends in sich selbst zurück zieht, die Teilnahme an der werkenden Gemeinschaft verweigert und so die Normen und Rollenbilder der frühkapitalistischen Gesellschaft zur Disposition stellt. Während Bartleby sein Ende im Gefängnis- bzw. Psychiatriehof findet, wird Herr Wosches Ausstieg laut Gunstheimers Genie/Talkshow (2008, siehe Abbildung) zudem in Talkshowauftritten medial gezähmt und spektakularisiert.
Im Genie (Labor) befindet sich eine Tribüne, ein Observatorium für die Zelle in einer dystopisch anmutenden Versuchsanstalt. Hier stehen die Besucher_innen – gewissermaßen in Vertretung des Forschungs- bzw. Überwachungsteams – auf der sicheren Seite eines deckenhohen Gitters. Als Panoptikum en miniature ermöglicht die Architektur eine lückenlose Kontrolle aller Vorgänge innerhalb des Gefängnisses und wird so zum physischen Gleichnis der heutigen Allgegenwärtigkeit von Überwachungstechnologien. Michel Foucault beschreibt das Panoptikum als „eine Form politischer Technologie,“ mittels derer Körper im Raum platziert und die Beziehungen von Individuen zueinander getrennt werden. Diese Art der hierarchischen Organisation, die Zentren und Taktiken der Macht definiert, erscheint in Gunstheimers Installation als doppelte Bühne. Während die Perspektive der Zuschauer_innen auf die verlassene Szenerie unter ihnen gerichtet ist, werden sie in exponierter Position selbst zu Beobachteten. Denn wer weiß schon genau, was in diesem Labor eigentlich erforscht wird.
Jana Gunstheimer ...
Die Werkreihe Genie wurde im Kunstmuseum Bonn (2008) sowie im Kunsthaus Erfurt (2009) gezeigt und ist dokumentiert in den Publikationen Nova Porta, Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken unter Aufsicht von Jana Gunstheimer, 2010, und Jana Gunstheimer, Methods of Destruction, 2012.
In der Medizin beschreibt man mit Wolfskindsyndrom bzw. Hospitalismus oder Deprivationssyndrom die körperlichen und psychischen Begleitfolgen eines Krankenhaus- oder Heimaufenthalts oder einer Inhaftierung. Auch die Störungen von manchen Tieren in Gefangenschaft fallen unter den Begriff des Hospitalismus. Aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Hospitalismus
Michel Foucault, Überwachen und Strafen, Frankfurt am Main, 1994.
Wenn Künstler ins Fabulieren geraten, Geschichten erdichten, fiktive Dokumente erschaffen, wenn sie in überzeugende Konstrukte Falltüren einbauen, die den Betrachter in unerwartete Fiktionen stürzen lassen, oder wenn sie ihre Lügengebäude auf Fundamenten aus Wahrheit aufbauen, dann zumeist, um damit auf die Brüchigkeit von Wirklichkeit zu verweisen, auf die Manipulierbarkeit und Konstruiertheit so genannter Fakten. Bei Jana Gunstheimer indes verhält es sich anders. Sie erfindet keine Geschichten, um unseren Glauben an die Realität zu erschüttern, sondern um unseren Blick für die Realität zu schärfen. Dafür hat sie in ihrer aktuellen Ausstellung "Heiligsprechung" recht verschiedenartige und auf Echtheit beharrende Belege und Beweisstücke aufgebaut, die Gunstheimers Legende von einer österreichischen "Staatlichen Behörde zur Kanonisation" untermauern sollen.
Dies ist ihre Geschichte: Da der österreichische Staat einen eklatanten Mangel an offiziellen Vorbildern beklagte, wurde 1976 die Behörde zur Kanonisation geschaffen, die ihre "Heiligsprechungen" jedoch nicht im Sinne der katholischen Kirche betreiben, sondern geeignete Bürger in den Rang von Nationalhelden heben wollte. Es stand demnach allen Bürgern frei, gegen die Zahlung einer beträchtlichen Gebühr sich selbst oder andere zur Kanonisation vorzuschlagen. Nach anfänglicher Begeisterung ebbte die Flut der Bewerbungen jedoch ab, zumal sich die Kandidaten einer schrankenlosen staatlichen Überprüfung aussetzen sollten. Um den Schein zu wahren und das Projekt aufrechtzuerhalten, wurden schließlich drei Österreicher kanonisiert, doch sorgte diese Entscheidung für derartige Unruhe in der Bevölkerung, dass die Behörde 1981 abgewickelt wurde. Allerdings, so Gunstheimers Legende weiter, ist die Gründung eines deutschen Ablegers im Gespräch.
Die Berliner Ausstellung in der Galerie Filiale, einer Dependance der Zürcher Galerie Römerapotheke und der Düsseldorfer Galerie Conrads, illustriert ihre Erzählung mit Exponaten, die von erklärenden Texttafeln begleitet werden, deren Wesen und Präsentation den Konventionen eines historischen oder völkerkundlichen Museums folgen (die Künstlerin studierte unter anderem Ethnologie) und verstärkt so die Überzeugungskraft ihrer Fiktion. Inmitten der Galerie steht ein verkleinertes Modell des Ehrentors, das die Behörde zum feierlichen Zelebrieren der Kanonisation errichtet haben soll (Das Ehrentor der SBK, alle Arbeiten 2008). Es ist ein schauerlich schwarzes, rudimentäres Konstrukt, geschmückt mit Girlanden und bekrönt mit dem österreichischen Bundesadler. Zwei in Grautönen gehaltene Aquarelle, die wie Zeitungsausschnitte wirken, zeigen eine Ansicht des aufgebauten Tors (Das Ehrentor der SBK) sowie die vermeintliche Pressefotografie einer Demonstration aufgebrachter Bürger vor der Behörde (Berichterstattung in der "Wiener Zeitung" vom 17. März 1979 über die Proteste vor dem Hauptgebäude der SBK). Ein weiteres Ausstellungsstück in Gunstheimers musealer Darbietung ist ein Dreiersatz Briefmarken mit den Porträts der kanonisierten Österreicher - Heinrich Harrer sowie zwei fiktive Gestalten des öffentlichen Lebens (Kanonisierte Bewerber/Helden-Briefmarke).
Daneben zeigt Gunstheimer Dokumente und Devotionalien dreier abgelehnter Bewerber - und zwar jeweils das Bewerbungsschreiben sowie Objekte, die für die Kanonisierungswürdigkeit der vorgeschlagenen Personen sprechen sollten. Hierzu gehören die Klappbühne des "Wanderpredigers" Dr. Ferdinand Huber (#6178, Untergangshuber-Fanclub e.V. der Gemeinde Feldach: Wanderbühne des Dr. Ferdinand Huber), der schwarze Mantel eines ehemaligen Aufsehers in einem Kärntner Lager für russische Kriegsgefangene (#1743, Der Mantel des Werner Hofbichler) sowie Bilder der tätowierten Unterarme von Mitgliedern des Vereins "Steiermark angstfrei" (#2071, Steiermark angstfrei e.V.). Doch hier - wie überall in Gunstheimers Narration - tun sich Abgründe auf, die auf wahre politische und gesellschaftliche Verhältnisse verweisen. So entpuppt sich der vermeintlich vor Unheil warnende Huber als in höchstem Maße ausländerfeindlich, der einstige Lageraufseher hat während des Krieges Gefangene absichtlich hungern lassen und die Mitglieder des Vereins sind sämtlich bekehrte Kinderschänder und Gewalttäter, die nun zum Zeichen der Sühne Sprüche wie "Ich bin gut zu dir" oder "Du kannst mir vertrauen" auf der Haut tragen. Auch die drei angeblich Kanonisierten sind keine Lichtgestalten, wobei Gunstheimer sich im Falle Heinrich Harrers streng an die bekannte Faktenlage gehalten hat und auf die Kritik an seiner lange verschwiegenen Mitgliedschaft in SS und NSDAP anspielt. So gibt es immer wieder Momente, in denen Gunstheimer sich auf reale Vorkommnisse stützt, um das Fiktive noch plausibler erscheinen lassen. Die "Wiener Zeitung" beispielsweise existiert, die daraus präsentierten Ausschnitte jedoch nicht.
Das Vexierspiel mit Dichtung und Wahrheit führt Gunstheimer auch in ihrer Zeitschrift "Maßnahme" fort, die in der Ausstellung ausliegt und sich als journalistische Dokumentation der von ihr geschilderten Historie gibt. Hier lässt die Künstlerin Persönlichkeiten wie Thomas Bernhard, den niederländischen Modedesigner Bas van Putten, Georg Kreisler oder Bruno Kreisky in nachweislichen Zitaten recht finster über Wien sinnieren. Überhaupt scheint sich Gunstheimer stark an Kreisler - dessen Biografie sinnigerweise Georg Kreisler gibt es gar nicht heißt - und seinem bitterbösen und makabren Wiener Humor inspiriert zu haben, denn eine Freundin der subtilen Schilderung ist sie nicht. Ihre Ausstellung ist eher so etwas wie eine dreidimensionale Karikatur, ein politisches Kabarett mit Bildern und Objekten. Besonders in ihrer Zeitung operiert Gunstheimer mit den Mitteln der ätzenden Satire, wenn sie politische Slogans verdreht, auf dem Titel die konservative Losung "Leistung soll sich wieder lohnen" in "Martyrium soll sich wieder lohnen" verwandelt und an anderer Stelle fordert: "Menschen brauchen Härte".
Sicherlich sind die Parallelen zum Kunstbetrieb unübersehbar, doch greift eine Deutung der Ausstellung als Parodie auf kunsthistorische Kanonisierung und Musealisierungsprozesse zu kurz. Dafür ist Gunstheimers Blick dann doch wieder zu ethnologisch, sind die Anspielungen ihrer ungemein fantasievollen Fiktion auf das Zeitgeschehen zu vielfältig. Staatliche Durchleuchtung der Privatsphäre, unfreiwillige Selbstdenunziation, obskure Gebührenpraktiken, öffentlicher Widerstand, salonfähiger Rechtspopulismus, Fremdenfeindlichkeit und die Verstrickung angeblicher Biedermänner in Unrecht und nationalsozialistische Verbrechen, Vertuschung und Bemäntelung lässlicher Sünden - all diese Themen sind in die Struktur ihrer Ausstellung eingewebt und mit einem guten Schuss schwarzen Humors getränkt. Dass Gunstheimers Methode in anderen Sektoren kultureller Produktion - zum Beispiel im Film - ein geläufiger Standard ist und hin und wieder zu gewitzteren und subtileren Erzählungen geführt hat, kann man schwer bestreiten. Das besagt aber nichts anderes, als dass die politisch zum Pathos neigende bildende Kunst hier erhebliche Defizite hat. Jana Gunstheimer arbeitet daran, sie zu verringern.
“No-one has ever had any real interest in art. And no-one ever will." F.
So stated F in the hurriedly typewritten letter he covertly slipped into the first issue of Maßnahme, the quarterly newsletter of the semi-fictional organization NOVA PORTA. The 38-year-old character works in the group’s Art History Section, where he is charged with systematically eliminating the areas of pictures deemed in need of “cleaning up.” In his letter, he reported that Dutch paintings, with their “bloated bodies, drinking bouts, [and] gluttony,” have been singled out by the leaders of the organization that “insists on having healthy members.” He went on to disclose that significant government funding is provided for their activities, and that a strict code of silence prevents members from divulging pertinent information about the group to the local population. Shortly after this letter was distributed F disappeared.
Part self-help group, part Orwellian nightmare, NOVA PORTA is the creation of German artist Jana Gunstheimer (born 1974). The organization serves as a vehicle with which to parody real-world hierarchical structures and arbitrary bureaucratic methodologies. Gunstheimer responds to the transformations she sees taking place in contemporary German civil society—namely post-industrial desolation, drastic unemployment, and rising levels of aggression among her generation. Indeed, a fundamental principle of her project is that as civilization progresses, less labor is needed, and the resulting lack of function and purpose can lead individuals to destructive action that threatens the well-being of the community. Gunstheimer proposes an alternative society run by NOVA PORTA in which “People Without Social Function” can learn to re-direct their violent energies to more “positive” uses as determined by the organization, which ensures their physical welfare but in exchange shapes all aspects of their social being. She conveys her ideas through elaborate multimedia installations of exquisitely rendered photo-based grisaille watercolors on wood, paper, or the wall itself; intricate hand-drawn paper, aluminum, or rubber cut-out graphic forms; the occasional constructed model or theatrical stage set; and artist’s books. These handcrafted media are combined with an active Web site (www.nova-porta.de) and a quarterly printed newsletter through which interested parties can actually apply for membership.
This, however, is where reality ends and fiction begins, for all of the organization’s activities—social experiments, strange disappearances, crime scenes—are fabricated by Gunstheimer in a not-so veiled critique of contemporary society. Within these commentaries are implicit but inescapable allusions to post–Cold War life in her homeland. Such references are equally salient to those, like the artist herself, for whom the German Democratic Republic (GDR) is a mere childhood memory or an entirely foreign concept. The name NOVA PORTA is an inversion of the Spanish term porta nova, or new door; like the artist’s larger project, it is meant to sound completely plausible yet slightly off. The group’s logo, composed of an open door inside a cave within a tondo-like form (fig. 1), was inspired by a Fra Angelico fresco depicting Christ’s recently vacated grave, which acts as a symbol of the rebirth that NOVA PORTA offers its members. Gunstheimer developed the emblem in 2001 while studying photography at Ohio University. Fervent flag waving in the wake of September 11 prompted her to consider how such symbolic icons function and to produce her own banner in response. Within the varied elements of her project, nothing is spelled out. Instead the artist offers a series of traces, mere suggestions, of what NOVA PORTA is and does. We are encouraged not only to suspend our disbelief, but to plunge headfirst into the narrative.
Gunstheimer figures among a group of artists whose work calls into question how history is documented, discussed, and displayed, including Ilya Kabakov’s character albums and life-size evocations of imagined histories; Walid Raad/The Atlas Group’s archives dedicated to contemporary Lebanon; Bernadette Corporation’s “joke forms of business”; and David Wilson’s Museum of Jurassic Technology. In such works truths are manipulated in an effort to point out the sheer fallacy of the supposed binary relationship between fact and fiction. In Raad’s words, “We hold that this common-sense definition of facts, this theoretical primacy of facts—as self-evident objects always-already present in the world—to be flawed and that it must be challenged. Facts have to be treated as processes.” Gunstheimer’s art is a process; never complete, never resolved, her intricate tales continue to weave in and out of one another across projects. As she draws, writes, and imagines NOVA PORTA into existence, she becomes the architect of a world that encompasses both fictional characters, such as F, and actual individuals, including herself (the artist’s alter-ego serves as the organization’s Assessment Manager), anthropologist Thomas Hauschild, and philosopher Brian Massumi. In this sense, her work also relies on meta-fictional tropes in the manner of Jorge Luis Borges and Paul Auster. Yet the sheer artistry of Gunstheimer’s handcrafted production consistently disbands the illusion of truth and announces definitively her role as creator.
The skills and methods gleaned from Gunstheimer’s undergraduate studies in the ethnology of Indonesian and West African societies are applied to great effect in her interdisciplinary artworks about her own culture. For the project People Without Function (2004), she conceptualized an ethnographic experiment in which a group of thirty individuals agreed to live for ten years in a forested reservation that was controlled and monitored by NOVA PORTA. The objective was to see how people—in this case, former reality television contestants—reacted when their basic needs were met (food, clothing, and shelter) but, stripped of their occupations, they no longer served any social purpose. The idea of a reservation as a place of potential change is suggested in a quote on the organization’s Web site attributed to anthropologist Thomas Hauschild: “The naked life gathered in refugee camps… [is a] residual stage from which a new civilization can be founded, a reservation as a basis for action thinking and entering into the heart of nature.” The subjects in Gunstheimer’s test case were sequestered by NOVA PORTA; with correct training their energies could eventually be re-directed to further the ultimate goal of the organization—a complete restructuring of civilization at large.
The physical manifestation of People Without Function uses fabricated empirical data that Gunstheimer collected, analyzed, and recorded in the form of an artist’s book and mixed-media installation. The book opens with a quote by philosopher and theorist Brian Massumi: “Individual life is a serialized capitalistic crisis in miniature, a disaster that bears your name.” The same defining phrase appears on the NOVA PORTA Web site and in the first issue of Maßnahme. The artist encountered this phrase in a paperback she picked up at Volksbuhne Berlin, an avant-garde, anti-capitalist, state-subsidized theater where she frequently attends lectures with titles such as “Capitalism and Depression,” “Politics and Crime,” “Capitalism and Repression,” or “Happiness Without End.” The effects of capitalism are under scrutiny, if not wholly parodied, in projects like People Without Function. French theorists Gilles Deleuze and Félix Guattari propose a notion of capitalism that willfully “deterritorializes” or disorganizes society’s characteristic groupings: church, family, and other crucial social arrangements. But since it also requires social groupings in order to function, it must allow for “re-territorializations” and constant restructuring. These ideas are echoed in the rhetoric issued via NOVA PORTA’s Web site and newsletter: “Examine your social contacts and eliminate [negative] contacts from your network. You will not need them in the future. We are using the opportunity offered by the turning point of civilization to restructure, reorganize, and re-occupy our world.” Once it has identified and purged social structures in the workplace, among friends and family, and even in romance, the group recasts them in its own image. Gunstheimer employs this type of language with a subtle but deliberate irony. She invokes NOVA PORTA as the exemplary post-capitalist system, but uses it, in fact, to expose the absurd societal constructions already in place: governmental infringements on privacy in the name of security; self-help aids; cults (religious and otherwise); and tabloid media.
The artist staged a similar scenario in Stammsitz or The Ancestral Seat (2005), which was set at the Villa Hügel in Essen, Germany, the former family estate of the industrial tycoon Alfried Krupp. The house, now a tourist attraction, is either touted as a symbol of Germany’s glorious industrial past or condemned for its role in the perpetuation of the evils of capitalism. A third unfortunate correlation is Krupp’s participation in World War II as the primary weapons producer for the SS. Although these histories do not play directly in Gunstheimer’s project, the Villa Hügel as a site is all the more mysterious for its attendant associations. Here it serves as the scene of a crime allegedly committed by a renegade group of NOVA PORTA members who have adopted the mansion as their secret nighttime headquarters. A scale model of the villa was presented along with watercolors—painted to resemble a collection of evidence photographs—that depict the detritus left behind and the unusual rituals performed by the alleged outlaws (fig. 2). These “clues” lead us into a labyrinthine narrative in which neither the crime in question nor the specific perpetrators are ever identified.
Created especially for this focus exhibition, Status L Phenomenon (2007) centers on the premise that on June 4, 2007 (precisely a month before Independence Day), Chicago’s Lake Point Tower and several particularly upscale residences on Prairie and Clark streets became instantly blighted in a bizarre phenomenon of “lost status.” Each of the inhabitants who were home at the time is completely unaware that anything has happened. Conversely, for those who were away, the event has upended existence as they knew it. They search in vain for their chic homes and architectural landmarks, now vanished and replaced by dilapidated socialist-realist structures surrounded by slums. Working from photographs she took in Chicago and scenes of her own imagining, Gunstheimer pastiches multiple images together to form her desired compositions. A wild network of individual elements, the installation consists of “evidence” compiled as part of someone’s futile attempt to solve the inexplicable mystery. Fifteen framed watercolors on paper depict, in near trompe-l’oeil fashion, the illustrated reports of this strange occurrence as it ostensibly appeared in the headlines of the world’s major newspapers, including the New York Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, USA Today, The Guardian, and the Chicago Tribune. A Chicago city map drawn directly on the wall. Also included are intricate black paper and rubber cutouts, one of which, aptly subtitled Crisis!, depicts a ramshackle building.
The last and most critical component of the project is an artist’s book/intervention in the form of a newsprint insert. It was distributed throughout the city inside the Chicago Tribune on Tuesday, June 5, two days prior to the opening of the exhibition, and is also part of the gallery installation. The artist invited reporters to retell, in journalistic style, their own versions of the “lost status phenomenon” story, which was printed and appended—like F’s clandestine letter—to a legitimate news source. The location, multiplicity of voices, and tone of reportage lend credence to the plot, even in an age when sudden and devastating change to our environment is more plausible than we would like to admit. The infiltration of the non-art context of the Tribune allowed the artist to reach potential audiences that would have otherwise been unavailable to her. What readers ultimately make of a foreign entity that is neither news nor advertising in their daily paper will surely remain a mystery—or more precisely a truth peculiar to every reader.
NOVA PORTA and its members are conspicuously absent from Status L Phenomenon. Indeed, Gunstheimer refuses to reveal whether the organization has any involvement in the events. But as part of the People Without Function project, the participants experimented with a new breed of plant that could destroy buildings quickly and quietly by permeating and weakening the mortar between bricks. Section three of the organization’s Web site also offers this provocative statement: “When problems occur somewhere, we… adapt ourselves to the local circumstances. We regard depopulated zones, wastelands and abandoned areas as creative work environments. We re-occupy places steeped in history.” From these earlier aspects of Gunstheimer’s work, we can infer that the group will likely be implicated in the future.
Such interconnected narratives are central to Gunstheimer’s practice. No one image, installation, or even series of projects functions entirely independently of the rest. Her consummate drawing ability and mundane yet enigmatic subject matter—a single chandelier, or a mostly illegible page from the Frankfurter Allgemeine with the bizarre headline “Happy Birthday Amerika”—are marked by what one writer called “an oppressive sense of ambivalence.” This contradictory approach relies on the constant slippage between fact and fiction and social critique markedly absent of a distinct stance. What is certain is the resistance to meaning—the active avoidance of interpretation—that defines her work. Amidst a culture of bumper sticker philosophies, sound bites, and marketing slogans, there remain a few practices like Gunstheimer’s in which ideas are made more complex, rather than less, and in which ambiguity is a virtue. Pictures have the ability to represent worlds that do not cohere and have, in their refusal of complete understanding, political consequences. The universe Jana Gunstheimer creates questions the necessity of its own existence. What appears to be the very definition of dystopia is also a celebration of humanity’s will to creative action; the proof, in fact, that F got it all wrong.
Gunstheimer was struck by America’s overt patriotism given her German heritage, Germany being a country with a longstanding moratorium on public displays of nationalism.Quoted in Frits Gierstberg, ed., Documentary Now! Contemporary Strategies in Photography, Film and the Visual Arts (NAi Uitgevers, 2005), p. 121.For other discussions surrounding the artistic deployment of ethnology, both in theory and in practice see: Joseph Kosuth, “The Artist as Anthropologist,” The Fox 1 (1975); Hal Foster, “The Artist as Ethnologist,” The Return of the Real (MIT Press, 1996), pp. 171-203; Susan Hiller’s interview with Mary Horlock, PALETTEN, Stockholm, July 17, 2001 http://www.susanhiller.org.Brian Massumi, “Everywhere You Want to Be: Introduction to Fear,” in The Politics of Everyday Fear (University of Minnesota Press, 1993), pp. 3–38. The quote Gunstheimer saw was paraphrased and translated from English into German. She had it translated back into English and used that version on the Web site. The original line reads, “Emotional make-up is the face power turns toward the predictably unbalanced, saleably empty content of an individual life (serialized small-scale capitalist crisis). Life’s a soap—when it’s not a disaster with your name written on it.”
Susanne Altmann, Jana Gunstheimer (Jena: Marion Ermer Stiftung/Dresden Hochschule für Bildende Künste Dresden , 2005), p. 8.
T. J. Clark, letter to the editor in response to Arthur Danto’s review of his book, The Sight of Death, Artforum 45, 8 (Apr. 2007), p. 42.
In den stets schwarz-weiss angelegten Zeichnungen und Aquarellen Jana Gunstheimers ist die Dunkelheit Programm. Fast scheint es, als könne es in den ruinösen Räumen, den verwilderten und öden Brachezonen, aus denen die Künstlerin vornehmlich berichtet, nie wirklich Tag werden. Berichtet wird aus einer Schattenwirklichkeit, in der die Übergänge zwischen Fiktion und Fakt, zwischen Traum und Alptraum fliessend sind. Im düsteren Dämmer, der über den Szenen liegt, keimt ein existenzielles Gefühl der Ortlosigkeit und Verlorenheit.
Eben hier, in dieser postkatastrophische Züge tragenden Gegenwelt zu den strahlenden Shopping-Malls unserer „consumer reality", hat NOVA PORTA, die „Organisation zur Bewältigung von Risiken", ihr Betätigungsfeld gefunden. Mit schwer durchschaubaren Ritualen, Testspielen und Freizeitbeschäftigungen bietet sie all denen, die unter Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit leiden, eine Struktur, die enge Gruppenbindung und straffe Hierarchie mit struktureller Ziel- und Sinnlosigkeit verbindet. Damit zitiert das Projekt ebenso die grosse romantische Sehnsucht nach einer anderen - nicht den Effizienz- und Vernutzungszwängen unterworfenen - Wirklichkeit, wie es diese schlussendlich durch die entwicklungslos in sich kreisende Folgenlosigkeit ihrer Angebote ad absurdum führt.
Es spricht für die Intelligenz der Arbeit, dass Jana Gunstheimer bei der liebevollen Auslotung und Umkreisung ihres - selbstverständlich - erfundenen Firmenkosmos jeden Ansatz von Eindeutigkeit und Eindimensionalität vermeidet. Das gilt auch für ihre neue Werkgruppe. „Stammsitz" illusioniert das ehemalige Stammhaus der Krupp-Dynastie, die Essener Villa Hügel, als Domizil von NOVA PORTA, die dort „Personen ohne Aufgabe" (POAs) auf einem fortgeschrittenem Level in der Kunst guten Benehmens und vollendeter Form unterrichtet. Dabei verbindet die Serie die durch Repräsentation und Macht gesättigte Aura des Ortes mit den sinnlosen Höflichkeitsritualen der Probanden zu einem Zirkel der Ausweglosigkeit, in dem nichts mehr mit sich selbst identisch ist. Der permanente Balance-Akt zwischen Abbildung und Erfindung, der zu einer Verschmelzung von Fiktion und Realität führt, macht die Arbeit zu einer Metapher künstlerischer Tätigkeit überhaupt: dem Entwurf von Welten, die ihre Brisanz nicht aus ihrer Faktizität, sondern ihrer Potenzialität gewinnen.
Obwohl durchaus soziologisch grundiert, ist dieser künstlerische Mikrokosmos also gerade keine gesellschaftspolitische Abrechnung, sondern eher eine Allegorie auf eine sinnliche Halluzinationsleistung, die in der Erfindung von sich selbst widerlegenden Bildern besteht. Insofern dürfen wir in Jana Gunstheimer eine „Möglichkeitskünstlerin" sehen, die in den Nischen des Alltags Abenteuer sät, die, gerade weil sie sich selbst destabilisieren, einen bleibenden Eindruck hinterlassen.